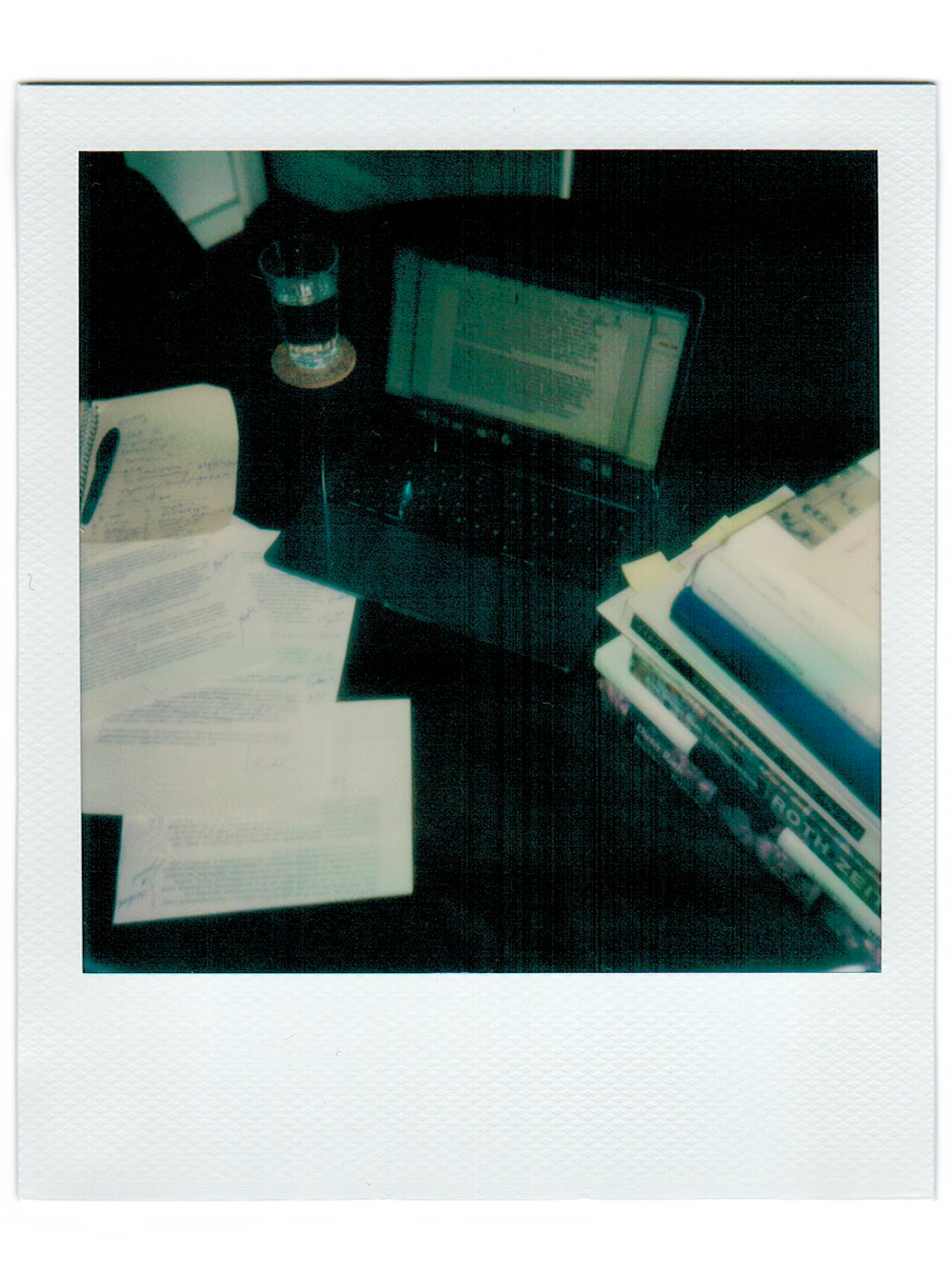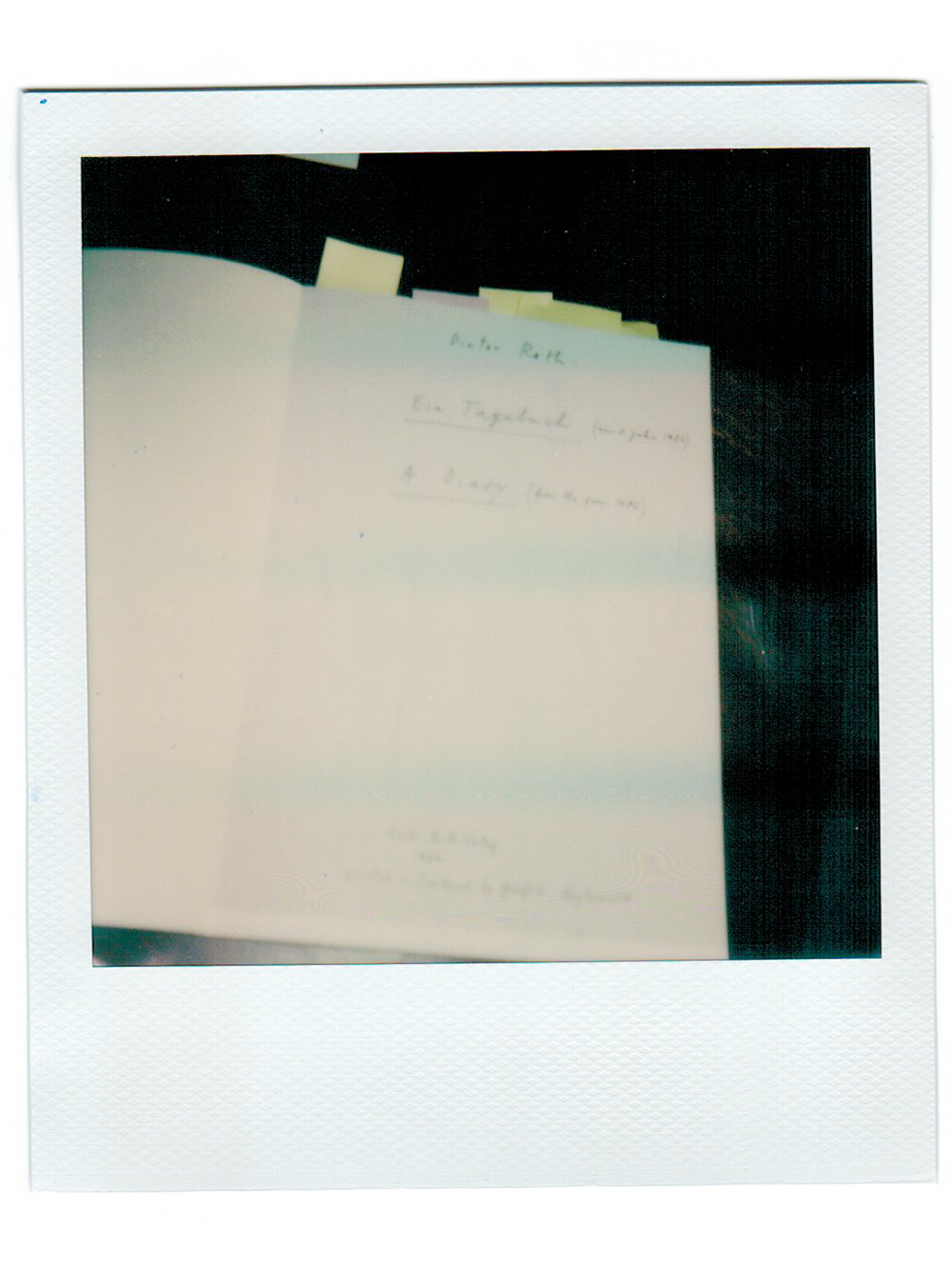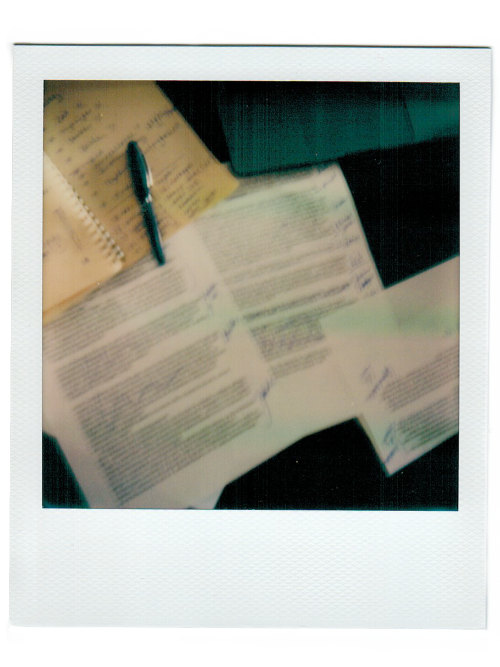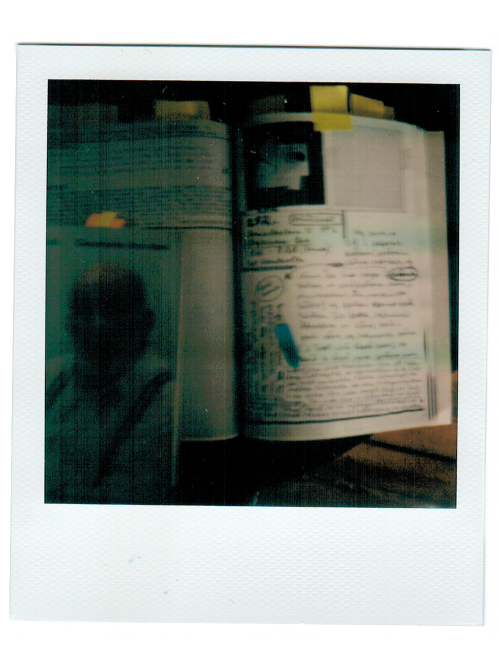Schreiben ist Ausweichen: Dieter Roth, das Ich und mich
Zu bestimmten Begriffen, Farben, Ländern, Figuren oder Daten hat man einen besonderen Bezug. Sei es, weil man ein bestimmtes biografisches Erlebnis, sei es, weil man eine bestimmte angelesene Geschichte damit verbindet. Besonders intensiv war schon immer mein Verhältnis zu Zahlen. Ungerade Zahlen liebe ich ungleich mehr als gerade, sie stehen mir näher. Und hat eine Zahl erst mal Bedeutung für mich erlangt, dann leuchtet sie aus dem Schriftbild oder der Zahlenkolonne geradewegs heraus und springt mir entgegen. Die offensichtlichste Wirkung hat mein Geburtsdatum. 31.01.1982. Diese Zahlenfolge und mit ihr vor allem die Zahl 31: Das bin ich, darin erkenne ich mich wieder. Wenn ich jemanden kennenlerne, der auch an einem 31. Geburtstag hat, egal in welchem Monat, fühle ich intuitiv eine Verbundenheit. Und jeder 31. Monatstag fühlt sich ein wenig an wie ein kleineres Geschwister meines Geburtstags.
Als ich mit Mitte zwanzig damit beschäftigt war, ein konkretes Beispiel zu finden, an dem ich mein geplantes, noch etwas diffuses kunsthistorisches Promotionsthema durchspielen könnte, traf ich auf eine solche plötzlich aufleuchtende Ziffer. Ich plante, über diaristische Strukturen in der bildenden Kunst zu schreiben, darüber, wie der Ablauf des Lebens und seine Dokumentation zur Kunst werden kann und was sich bei diesem Umwandlungsprozess verändert. Sophie Calle hätte mit ihrem autofiktionalen Projekt als Zimmermädchen oder später ihrer radikalen Zusammenarbeit mit Paul Auster und seinem Gotham Handbook zur Protagonistin meiner Promotion werden können; Timm Ulrichs, Marina Abramović und Vito Acconci, die ihre eigenen, privaten Körper und ihre Lebensgeschichte auf jeweils unterschiedliche Weise in die Kunst einbrachten und zur Kunst erklärten; On Kawara, der über das Vergehen von Lebenszeit reflektiert. Fündig aber, wegen des blitzhaften Aufleuchtens, wurde ich bei Dieter Roth.
Ich hatte mir im Internet ein teures antiquarisches Exemplar von Ein Tagebuch (aus dem Jahre 1982) bestellt, dem Katalog zu Dieter Roths Auftritt im Schweizer Pavillon der Venedig Biennale 1982. Die Ziffer 1982 im Titel, das Jahr meiner Geburt, hatte mich gleich angezogen und das Begehren ausgelöst, diesen Katalog zu besitzen. Als das Buch bei mir eintraf, blätterte ich angemessen andächtig die Seiten der im Selbstverlag kopierten und auf Island gedruckten Seiten durch. Pro Tag ein oder zwei alltägliche Polaroids aus dem Künstleratelier, im ersten Teil mit rein protokollarischen Notizen versehen (wo, wer und wann), ab dem 17. März dann begleitet von zunehmend erzählerischen, selbstreflexiven, ausschweifend berichtenden Einträgen, alles handschriftlich, als collagiertes Faksimile. Eine Mischung aus Arbeitsjournal und Selbstbeobachtung.
Von dem Zeitpunkt an, als das Schweizer Bundesamt für Kulturpflege seine Entscheidung für ihn als ausstellenden Künstler auf der Venedig Biennale verkündete, hatte Dieter Roth begonnen, ein darauf abzielendes Tagebuch zu führen. Filmisch, fotografisch, schriftlich. Die Ausstellung in Venedig im Juni des Jahres schließlich bestand aus dreißig Fernsehern, auf denen gleichzeitig dreißig verschiedene Super-8-Filme abgespielt wurden, die den Künstler Roth in seinem alltäglichen Umfeld im Atelier zeigten.
Täglich stattfindendes Gelebe
nennt Dieter Roth selbst das Gezeigte im Vorwort. Zur Venediger Biennale wurde zudem ein Katalog publiziert und zur kostenlosen Mitnahme an alle Besucher des Schweizer Pavillons verteilt – eben dieser Band Ein Tagebuch. Die Ausstellung bestand also aus Filmprojektionen, die das Vorbereiten der Ausstellung und die alltägliche künstlerische Arbeit zeigten, der Katalog bestand aus einem täglichen Protokoll der Vorarbeit zur Ausstellung samt fotografischer Dokumentation und schriftlichen persönlichen Ergänzungen.
Eine zusätzliche Attraktion dieses Bandes bedeutete für mich neben der Faszination für dieses aufgezeichnete Aufzeichnen Roths und dem Entstehungsjahr aber vor allem ein weiteres Datum: der erste Tageseintrag nach dem Vorwort. Er ist datiert auf den 30./31. Januar 1982, den Vortag und Tag meiner Geburt, zu denen Dieter Roth mit seinem Sohn Björn in Stuttgart einen Schallplattentransport von der Danneckerstraße 32 zur Haussmannstraße 200 durchführte. Diese Eintragung ließ sofort eine Vielzahl an Fragen in meinem Kopf aufleuchten. Hatte das etwas mit mir zu tun, wenn es mir, meiner Biografie, so auffällig nahekommt? Und: Machte das etwas mit mir, dass »ich« mit diesem Datum in diesem Buch steckte? Die zweite Antwort war ganz einfach: Ja, natürlich machte das etwas mit mir, es ließ mir gar keine andere Wahl, als mich selbst in diesen Text hineinzulesen, mich selbst in ihm als Nebenstrang mitzulesen. »Jedes Datum ist Handlung; alles übrige ist Schatten, ist Raisonnement«, schreibt Johann Gottfried Herder im Journal meiner Reise im Jahr 1769. Die Handlung, die im initialen Datum des Roth’schen Tagebuchs steckte, war nicht nur die Handlung seines Venedig-Projekts. Sie war ebenso die Handlung meiner Geburt. Und damit war unmittelbar entschieden, dass ich hier mein Promotionsthema vor mir liegen hatte.
Doch was lag denn hier eigentlich vor mir? Der Buchtitel markiert ganz eindeutig ein Tagebuch, also eine tageweise Mitschrift von gelebtem Leben. Das Tagebuch als Gattung entstammt einer religiösen Innenschau, der Selbstbetrachtung und -beobachtung, dem pietistischen Zusammenhang der inneren Prüfung. Es bildet laut Rüdiger Görner eine »Brücke zwischen Pietismus und Existenzialismus«. Folgt man Roth selbst, vor allem in seinem programmatischen Vorwort, das er zum Abschluss der Aufzeichnungen verfasst hat, nachdem alle Eintragungen fertig waren, so entstand dieses Tagebuch in dem Versuch, die Wahrheit zu vermeiden und zu verwischen. Er wollte Bekenntnissen oder Festlegungen aus dem Weg gehen, im »Flimmern« der Eindrücke einen ungefähren Eindruck geben, aber keine Aufklärung.
Ich wollte mit den Filmen hier mein täglich stattfindendes Gelebe zeigen. Fand aber bald, ein riesengrosser Teil meiner Bewegungen, Aktionen, Reaktionen, Produkte, dient der Repräsentation des Gehorsams – ich gehorche moralisch-technischen Vorschriften einer inneren Stimme, welche nicht die der Lust oder Furie ist, sondern Kamuflage wünscht. Ich folge Rezepten (meiner Ängstlichkeit), meiner Angst vor Menschen (Tiere treffe ich äusserst selten, habe ihnen noch keine innere Stimme in mir gegeben).
Also gabs nichts Mutiges zu tun und dann (im Film) zu zeigen, sondern, höchstens, die Umwege um mutig gelebte Ereignisse herum
z. B. mutig wäre, schlecht aufgenommene oder wenigsagende Filme deutlich, vereinzelt, zu zeigen (vorzuführen; aus Angst vor solcher Blosstellung will ich 30 Filme dieser Sorte aufeinmal zeigen – ein Flimmern vorführen welches blendet und von der Armut des einzelnen Filmes ablenkt. (Einigermassen mutig erscheint es, gewisse Ängste zuzugeben; also: dieser Text.)
(…)
Ich nehme (habe genommen) den leichten Weg ›an die Oberfläche‹, oder nicht? Ich fummele an mir, an den Leuten, an den Landschaften, Wohnungen, Arbeit, Vergnügen, Freud und Leid, einfach so dran und drum herum, und sage dabei, dazu, daher: Besseres (was immer das Wort »Besseres« bedeute) ist mir nicht zu tun, zu geben, zu entdecken möglich.
(Die Texte) Der Text gibt, vielleicht, dem Leser eine Vorstellung (im Theater-Sinn) vom dünn=dicken, seicht=tiefen Gewebe des unablässig murmelnden inneren Geredes. (Obs das gibt, ob man davon reden und schreiben kann ist nicht gewiss – niemand hat noch das innere Gerede eines anderen vernommen.
Roth sagt dazu:
Den größeren Teil von dem, was mir bewusst ist, also was ich literarisch schreiben könnte, das habe ich weggelassen (…) das ist die Beschäftigung mit anderen Leuten auf eine wütende und missgünstige, negative Art.
Er hat sich also, eigentlich in ganz klassischer Tradition des Tagebuchs, auf sich konzentriert, die Selbstbeobachtung in den Mittelpunkt gestellt. Dennoch ist auch die Außenwelt mit dem Kunstbetrieb Teil des Tagebuchs. Freimütig festgehalten werden die Planungen für Venedig, die Filmarbeiten für die später gezeigten Filme, alkoholische Abende mit Freunden in Stuttgart, der Schweiz, auf Island oder wo auch immer die Roth-Familie sich gerade aufhält. Aber all das bietet nur Ankerpunkte im Meer von Selbstzweifel, Selbstekel, Selbsthass. Die Wut und den negativen Blick auf sich selbst hat Roth mitnichten ausgespart. Auf die Frage, warum er seine Tage so exzessiv dokumentiert und sie und damit sein Alltagsleben dann sogar noch ausstellt, gab Roth später zur Antwort:
Das ist das, was mich beschäftigt, oder. Wer denkt nicht an sich die ganze Zeit? Wer passt nicht auf sich auf? (…) Ich bin frei, mein eigenes Elend anzuschauen. Und nur da bin ich frei.
Über Roths Antrieb, über seine Schreibbewegung, schreibt Stefan Ripplinger im Begleitheft zur Ausstellung SELBSTE: »Roths sprachkritischer Zweifel gegenüber dem Schreiben über sich selbst ist Anlass, über sich selbst zu schreiben. Denn einem Schreiben über sich selbst geht die Frage voraus, ob es möglich sei, über sich selbst zu schreiben. Wer die Frage bejaht, verfällt fast immer auf die Abziehbilder des Ich. Wer sie verneint, gräbt sich selbst das Wasser ab. Allein einer wie Roth, der die Frage nicht beantworten kann, fährt darin fort, interessant über sich selbst, aber auch gegen sich selbst zu schreiben.« Roth schreibt sogar so sehr und so wörtlich »gegen sich selbst«, dass er auf sprachlicher Ebene im Satzgefüge »sich selbst« weglässt, nämlich das »Ich«. Inhaltlich verkleinert er sich, argumentiert er gegen die Qualität seiner Kunst und legitimiert sein Scheitern. Was zurückbleibt, ist eine deutlich markierte Leerstelle. Eine Passage aus dem Tagebuch 1982 als Beispiel:
Merke, beim Schreiben, dass nicht aus unmittelbarem Genuss (zum augenblicklich empfundenen Genuss) schreibe. Schreibe sozusagen auf jenen Genuss hin, den erwarte zu empfinden, wenn die fertige Schrift abliefern kann. Also etwas vorzeigen kann (einen Haufen Handgreifliches) an einem Ort und bei einer Gelegenheit wo vorzuzeigendes gefragt ist. Denke oft: Die Besucher der Ausstellungen fühlten sich wohl (wohler) wenn die Ausstellung als eine mislungene ihnen erscheinen kann, dann hat der Ausstellende nichts zu triumphieren, Abgesehen davon, dass ich den Mut nicht habe, solche Sätze in Gegenstände umzusetzen (eine schlechte Ausstellung zu machen), habe nicht die Unfähigkeit zu miesen, widerlichen Dingen in Gestalt von Bildern oder Gegenständen. Schon, wenn etwas an der Wand hängt – was immer – ist es nicht mies. Es hat Material-Struktur (also ornamentalen Reiz), und selbst ekelhaftes Material erscheint auf Bildern – wenigsten einigen Leuten – zumindest ironisch (gelungen).
Das »Ich« Dieter Roths, das diese Zeilen protokolliert, entzieht sich als Begriff aus den Zeilen, geht mir als Leser aus dem Weg und meidet meinen Blick. Bei der Lektüre ist das eine irritierende Erfahrung. Sofort frage ich mich als Leser, wohin sich das Ich wohl zurückgezogen hat, und sofort gehe ich dem nach, in meinen Überlegungen, aber auch im Text – ja, sogar in den Text. Ich lese die Sätze langsamer, genauer, weil ich den verborgenen Rückzugsort des Ichs aufspüren will, aber auch, weil ich mich nach Indizien dafür umschaue, warum das Ich genau hier, an dieser Stelle verschwindet. Einerseits kommen die Zeilen aufgrund des Notizcharakters intimer daher, das schreibende Ich muss sich selbst nicht mehr bezeichnen, es ist ja schon da, als handelnder, verfassender Akteur. Andererseits schotten sich diese Sätze aber auch gegen mich als Leser ab, provozieren mich, indem sie verweigernd verneinen, sich selbst zurücknehmen, bis hin zur vollständigen Tilgung.
1981, also noch bevor das Venedig-Projekt gestartet oder überhaupt geplant war, wurde Dieter Roth nach seinen Plänen gefragt: Gibt es so etwas wie ein großes Werk, das Sie irgendwann realisieren möchten?
Ja, ich führe ständig Tagebuch, zweifache Tagebuchführung. Ich möchte da alle philosophischen Ideen registrieren und aufzeigen, dass sie nichts bedeuten. Nichts.
Roth verneint in einem fort und kann von gar nichts anderem als seinem eigenen Scheitern ausgehen. Er hat das so weit verinnerlicht, dass er nur noch darüber nachdenkt, wie er das eingestandene Scheitern künstlerisch nutzbar machen, in einen Ertrag umwandeln kann. Die verschiedenen Ebenen des Tagebuchs 1982, die genau in ihrem Wechselspiel und in ihrer Vielschichtigkeit die Lektüre so interessant machen, sind Ergebnisse einer Vermeidungsstrategie, sie sollen das schon erwähnte »Flimmern« bewirken, das den Fokus zerstreut und durch Überfülle von den einzelnen Mängeln ablenkt. Roth selbst beschreibt diesen Prozess im Tagebuch 1982:
Kann einigermassen schlafen und die Vorarbeiten z. Biennale-Katalog (Aufkleben der Fotos) anfangen, aber noch keine Kraft zu schreiben.
– Seit 3–4 Wochen kommt die Idee immer deutlicher (und erschreckender) herauf, die Polaroids mit Texten zu begleiten, vielleicht oder: sicherlich, um die wahrscheinlich abstossende Öde und Inkompetenz der Filmschau aufzuwiegen, mit (Darstellung von) Reflektionen, welche das Misglückte als begehrens- oder erstrebenswert zeigen.
z. B.: Wenn die Filme als miserabel erkannt werden sollten, – sie mit diesen Katalog-Texten darstellen (beweisen?) als (im gewohnten Sinn: klare, reichhaltige Übersicht gebend) ängstlich die Norm erfüllende Anstrengungen, die ich nicht hab wollen.
z. B.: Die Produkte ängstlicher Tätigkeit – wenn sie allgemein gewohnte Qualitäten zeigen – als nicht erstrebenswerte zeigen.
z. B.: Die Produkte ängstlicher Tätigkeit – wenn sie das Gegenteil gewohnter Qualitäten zeigen – als Produkte des Mutes zur Ängstlichkeit vorzeigen. Die Filme werden, ganz sicher, im gewohnten Sinn schlecht sein, da ich (wir: Björn auch) weder Geduld noch Übung dazu haben; wir können nicht. Meine Hoffnung (?) also: Sie werden anderen Nichtkönnern, fast allen Betrachtern, die Freude geben zu sehen: Siehste wohl, der Roth kann auch nicht! Sie könnten auch Könnern die Freude bringen zu sehn, dass sie mich nicht beneiden müssen.
Laut Rüdiger Görner ist das Tagebuch »die der Zeit gemäße Form des Schreibens; die Fragen, die es aufwirft, bewegen, weil sie immer von einem suchenden Ich gestellt sind«. Was sucht nun Dieter Roth in seinem Tagebuch?
Es ist ein Tagebuch auf Zeit, die Mitschrift einer gewissen abgegrenzten Zeitspanne in Vorbereitung auf die Biennale in Venedig. Und weiter Görner: »Obgleich immer auch eine (Sozial-)Geschichtsquelle, sollte man das Diarium doch vorrangig als einen Werkstattbericht des Lebens interpretieren.« Das Tagebuch 1982 ist jedoch, auch wenn es auf den ersten Blick so scheinen mag, genau kein Werkstattbericht, kein Verzeichnis des Geleisteten, sondern vielmehr ein genuin künstlerischer Ausdruck des bildenden Künstlers Dieter Roth. Die Beschränkung durch die Form des Tagebuchs setzt eine besondere schöpferische Kraft frei. Das streng abgezirkelte formale Gerüst erklärt eine gewisse Zeit des eigenen Lebensablaufs zur Kunst. Es ist ja nicht nur das Schreiben des Tagebuchs, zu dem Roth sich entschlossen hat. In Roths Tagebuch 1982 ergeben Bild (filmisch bewegt wie fotografisch fixiert) und Text eine unauflösbare Verbindung der gegenseitigen Beglaubigung. Die Form von Bild plus Text gibt den Rahmen vor und erzwingt gewissermaßen auch die einzelnen Bestandteile. Entbindet die Erfüllung des Musters die einzelnen Bestandteile vom Zwang, sich aus sich selbst heraus inhaltlich zu legitimieren?
Dieser Tage könnte ich nicht mehr sagen, was ich mit diesen Filmen zeigen will; habe sogar vergessen, was ich anfangs (vier Monate vorher) zeigen wollte oder aufnehmen wollte, oder wie ich über die Filmerei gesprochen habe. Jetzt ist etwas Deutliches nicht mehr diese Tätigkeit (filmen), sondern die Beschreibung des Abzuliefernden und dazugehörend, die Daten des Ablieferungstermines: »300–400 Super-8-Filme; Polaroids von den Räumen oder Gegenständen wo gefilmt wird; Texte zu (neben) den Polaroids. Aufhören mit dieser Tätigkeit sobald 400 Filme gemacht sind und auf die Präsentation Anfang Juni hin vorbereiten, besser: fertigmachen«.
Die Dokumentation des Lebens beginnt, das Leben selbst zu ersetzen. Es wird dadurch komplexer, gewinnt eine stabile Reflexionsebene hinzu. Der unablässig sich selbst beobachtende und reflektierende Roth dazu:
Noch ein Phänomen: Das was ich »mein Leben« nennen könnte besteht jetzt (1982) fast ganz aus technischer Betätigung zur Erfüllung der Pläne meines Ehrgeizes + Besitzgier (Besitz-Sehnsucht eher zu nennen (?): Irgendwo auf einem Orte sitzen (Hausbesitz z. B.) und »die Aussicht (auf mehr oder weniger fernen ›weiteren‹ Besitz oder Applaus) geniessen«.
Die ambivalente Ritualisierung ist ein Phänomen, das sich an vielen Tagebüchern beobachten lässt. Was produziert was? Produziert das Bewusstsein der täglichen Mitschrift erst die Ereignisse, oder sind es umgekehrt die Ereignisse, die diese Mitschrift bewirken? »Strukturieren die Lebensereignisse das Tagebuch, oder strukturiert das Aufschreibesystem Tagebuch die Lebensereignisse?«, fragt Arno Dusini in seiner Studie über das Tagebuch. »Oder nochmals einen Schritt zurückgehend, weil wir hinsichtlich des Zusammenfalls von Schreiben und Geschriebenem im Gleichmaß der Tage von ›scheinbarer‹ Leichtigkeit gesprochen haben: Welcher Bedingungen und Umstände bedarf es, dass Schreiben und Geschriebenes im Zeichen des Tages überhaupt zusammenkommen?« Auch Rüdiger Görner geht dieser Frage der Struktur nach: »Die Zeit verlockt zum Ritus. Aber nur, wer ihr Inhalte abgewinnt, verhindert, dass sie als Selbstzweck vergeht.« Und als Beispiel aus der praktischen Erfahrung des Tagebuchschreibers berichtet der französische Schriftsteller und Ethnologe Michel Leiris, auch ein extensiver Tagebuchschreiber: »ich denke mich in Tagen, in Monaten, in Jahren; ich zersetze damit meine Privatsphäre und unterwerfe sie dafür einem unpersönlichen Rahmen, der ihr logischerweise ganz fremd ist. (…) Der einzige Sinn des ›Tagebuchs‹ liegt gerade in diesem lächerlichen aussichtslosen Unterfangen, in diesem alchimistischen Versuch, zu einer absoluten Einheit zu verschmelzen, was zwangsläufig als getrennt erscheint.«
Das Problem der Einheit hat Dieter Roth mit seinem Tagebuch nicht. Zumindest nicht in der Struktur: Der Zweck, nämlich der Weg hin zur Venedig Biennale, gibt die Einheit bereits vor. Doch im Tagebuch gibt es eine Vielzahl von Brüchen. Roths Stimmungsschwankungen – ob man sie nun Depressionen, Ausfälle oder Sinnkrisen nennen will – reißen Löcher in die Tagesabläufe, die gefüllt werden durch das Einspringen von Sohn Björn und Frau Vera als Tagebuchschreiber. Und nicht nur, dass andere Personen als der namentlich verzeichnete Autor Dieter Roth plötzlich mit Autoranspruch an seiner Stelle ins Tagebuch dringen, durch die abweichende Handschrift unübersehbar (Sohn Björn trägt zudem als Regisseur oder zumindest Kameramann die Filmsequenzen und manche Fotos bei). – Mit ihnen vollzieht sich auch noch ein Sprachwechsel. Beide schreiben ihre Einträge auf Isländisch. Die Sprache entwickelt sich damit (für die meisten potenziellen Leser und in jedem Fall für mich) ins Unverständliche. Und dennoch ergibt sich ein Gesamtkomplex, die Struktur des Entstehungszusammenhangs ist so stark, dass sich alle Komponenten trotz offensichtlicher Brüche in ein Werk fügen.
Zurück zur Ausgangsfrage der geplanten Doktorarbeit, zum Verhältnis von Leben und Kunst. Private, öffentliche, veröffentlichte Tagebücher sind keine Seltenheit. Was unterscheidet Roths Projekt von einer einfachen Mitschrift?
Es ist wahrscheinlich die Zurückhaltung, die Beschränkung in der Auswahl, was Zugang ins Tagebuch bekommt, auf das Nicht-Aufsehenerregende, auf das üblicherweise Nicht-Aufschreibens- und Nicht-Festhaltenswerte. Dieter Roth gibt in den abgefilmten Szenen der Langeweile und der Konzentration kaum etwas preis, er gibt dem Betrachter praktisch keine Möglichkeit, mitzuverfolgen, was eigentlich gerade künstlerisch passiert. In seinen schriftlichen Aufzeichnungen und Erläuterungen öffnet er die Tür einen Spalt weit, lässt teilhaben an Sinnkrisen, dem reflexiven Entstehen von Gedanken, an den ihn antreibenden Komplexen. Und tatsächlich beginnt dieses Spiel von Nähe und Distanz, von Außenansicht und Inneneinblick, zu kippen – es wendet sich ins Exemplarische. Wir sehen einen Künstler, beim Denken, beim täglichen Erleben und Erarbeiten, lesen von dem, was ihn beschäftigt und umtreibt. Ist es noch Dieter Roth? Oder ist es schon längst »der Künstler«, der hier im künstlerischen Ringen um Ausdruck und Formgebung sichtbar wird, den wir hier mitverfolgen können beim Entstehen dessen, was wir gerade betrachten und in uns aufnehmen? Hat sich Dieter Roth mit dieser Kippbewegung nun gänzlich heimlich aus dem Tagebuch herausgeschlichen?
Wie kommt ein Tagebuch zu seinem Ende? Dieter Roths Tagebuch 1982 hat ein von Anfang an vorgegebenes Ende, weil es in einer auf einen bestimmten Termin festgelegten Ausstellung gezeigt wird. Es ist Bestandteil eines Kunstwerks, das in der schon vorab terminierten Ausstellung kulminiert. Doch es gibt auch andere Möglichkeiten: »Das Spektrum der Tagebuch-Enden reicht vom Ende der gesamten Tagebuchaufzeichnungen über die Enden einzelner Teile bis hin zu den Enden der TAGE«, schreibt Dusini dazu.
Das Ende meines Promotionsvorhabens vollzog sich prosaischer. Ich wechselte die Stadt, verlor den Kontakt zu meiner Doktormutter und damit auch zum akademischen Betrieb – und lernte bei einem Abendessen den Verleger Andreas Rötzer kennen, in dessen Verlag Matthes & Seitz Berlin ich schon gleich am darauffolgenden Tag als Praktikant anfing. Die Entflammung fürs Büchermachen, die unmittelbar erfolgte, kam bis heute nicht zum Erlöschen und drängte alles Weitere so sehr zur Seite, dass sich die Exmatrikulation und damit die endgültige Absage an die mögliche Doktorarbeit knapp zwei Jahre später fast laut- und widerstandslos vollzog.
Was zurückbleibt, ist ein weiterer Eintrag in der ins Unendliche reichenden Bibliothek der ungeschriebenen Bücher – die ich mir nicht anders als das Paradies vorstellen kann.
Sebastian Guggolz studierte Kunstgeschichte, Germanistik und Volkskunde in Hamburg. Nach einigen Jahren als Lektor bei Matthes & Seitz Berlin gründete er 2014 den Guggolz Verlag, in dem er Neu- und Wiederentdeckungen vergessener Klassiker aus Nord- und Osteuropa in neuer Übersetzung herausgibt.
Die Polaroids wurden aufgenommen von Sebastian Guggolz, 12.02.2021.
>> Weiteres Textmaterial <<
Produktion: Holm-Uwe Burgemann
Hat Ihnen dieser Text gefallen? PRÄ|POSITION ist als gemeinnütziges Projekt der »Förderung von Kunst und Kultur« verpflichtet. Das Kollektiv arbeitet allein für den Text. Doch ohne Mittel kann auf Dauer selbst Kultur nicht stattfinden. Werden Sie Freund:in von PRÄ|POSITION und unterstützen Sie uns über PayPal, damit auch kommende Texte lesbar bleiben.