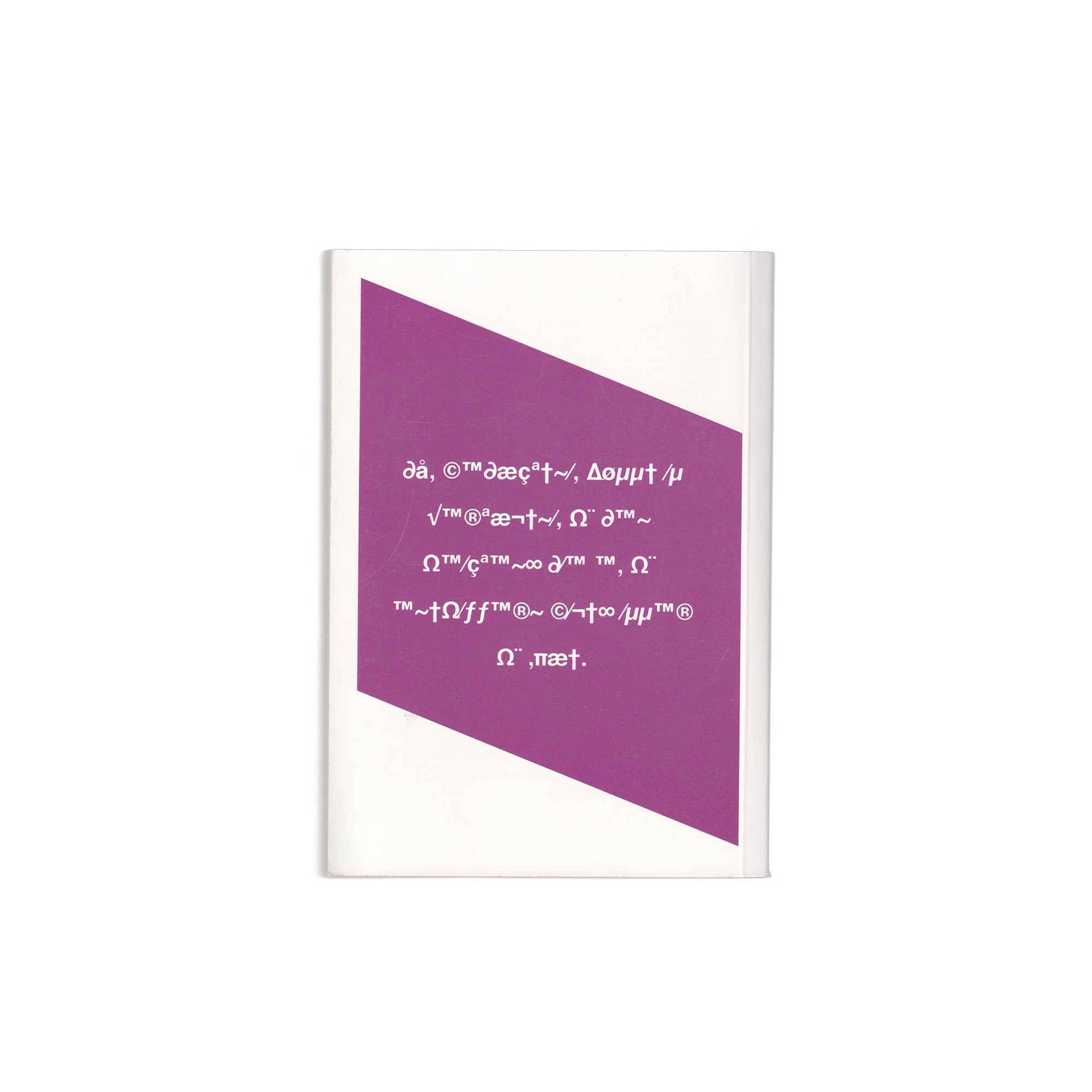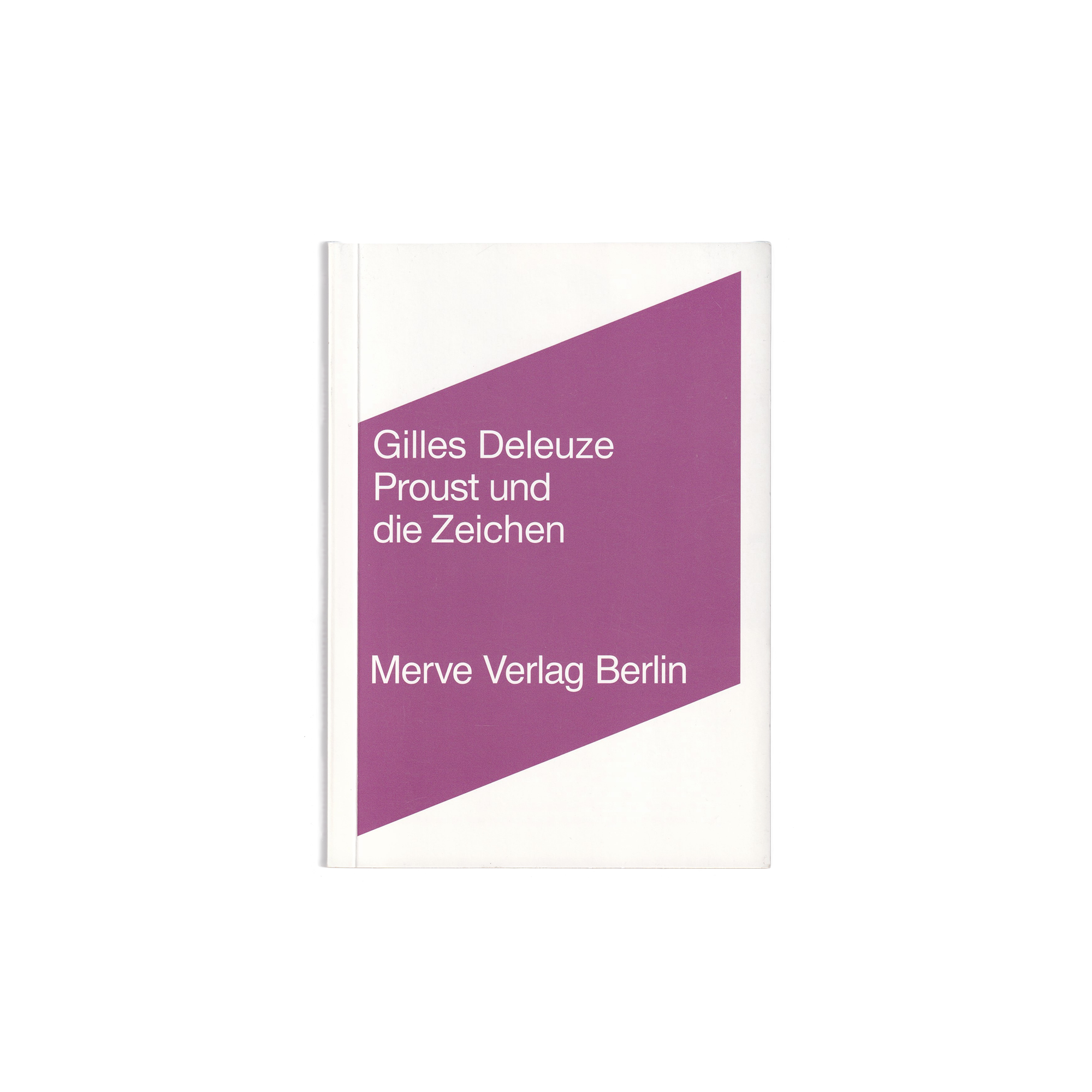#55 Gilles Deleuze: Proust und die Zeichen
Der große Roman von Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, ist für Eingeweihte nur die Recherche. Eine Suche, die Leben dauert. Für Gilles Deleuze ist es die Suche nach der Einheit der Zeichen, von der aber nicht klar ist, ob sie denn in den Sätzen verschüttet liegt, die der große Autor schrieb oder jenen, die wir selbst schreiben. Proust und die Zeichen ist eine uneindeutige Überschrift, denn sie kündigt eine Beschreibung von Proust und den Zeichen an (Proust und seine Zeichen) und beabsichtigt sodann etwas scheinbar anderes, eine ganze Zeichentheorie (Proust und dann die Zeichen).
Als ich mit Martin Saar das erste Mal bewusst über Marcel Proust spreche, am Rande seines Frankfurter Kolloquiums, an dem ich damals versuchsweise teilnahm, sage ich ihm nicht, wie wenig ich tatsächlich von der Recherche gelesen habe und wundere mich stattdessen im Anschein echter Leserschaft über eine hundert Seiten lange Szene des vierten Bandes. Woraufhin er beiläufig erwidert, man könne ja blättern. Auf der Seite der Marcel Proust Gesellschaft lese ich später, es gebe genau zwei Leseweisen der Recherche: forschend oder hedonistisch.
Martin Saars Antwort auf die erste Frage dieses Gesprächs spricht das Glück aus, das die Suche mit Proust bedeuten kann – ein Lesen auf von der Sonne erhitztem Sand, vielleicht sogar auf dem Cirque de la Madeleine, während die anderen längst Auf Wiedersehen sagen, weil sie Schöneres vorhätten – und betrifft schließlich auch Gilles Deleuze eigene Bindung an Proust: Warum ist die Literatur in der Philosophie so unsichtbar, wo sie für ihre Autor:innen doch so wichtig ist? Und warum überhaupt noch Philosophie, wenn es doch Romane gibt.
Wann haben Sie zum ersten Mal Prousts Recherche gelesen?
In Südfrankreich in einer der Schluchten der Ardèche, in die ich im Jahr vor meinem Abitur mit Kletterern als einziger Nichtkletterer gereist war.
Und wann haben Sie zum ersten Mal Deleuze gelesen?
Das weiß ich nicht mehr. Das müsste ich mal in meinen Büchern nachsehen. Immer aber im Zusammenhang mit Foucault. Deleuze wurde für mich zu einem wichtigen philosophischen Autor, den ich zur Kenntnis genommen habe, weil er im Foucault-Umfeld stand und weil die Leute, die sich in meiner Studienzeit ebenfalls für Foucault interessiert haben, sich oft noch stärker für den übrigen Poststrukturalismus oder für das, was damals noch Postmoderne hieß, interessiert haben. Deleuze stand für einen anderen Denkstil, der mich damals, in den ersten Jahren, nicht ganz so fasziniert hat wie die Foucault-Texte oder Derrida-Texte. Dass ich die Stärke und auch das ganz Besondere und Singuläre dieser Sprech- und Denkform schätzen gelernt habe, das war erst später. Also kein falling in love with Gilles immediately. Anders als bei Proust.
Das Gedächtnis kommt immer zu spät
Diese beiden Fragen kommen gerade im Text von Proust und die Zeichen zueinander, da sie zeigen: Es gibt ein Lesen der Literatur, das vorher kommt, auch in Ihrem Fall, und es gibt ein Lesen der Philosophie, das nachher kommt, das vielleicht auch zu spät kommt. Und das ist vor allem interessant, wenn wir uns die Rückseite dieses Merve-Büchleins, die völlig kryptisch ist, näher anschauen. Dort sehen wir Zeichen, die wir nicht lesen können. Kein normaler Text also, dafür aber Copyright-Zeichen und Trademark-Symbole, griechische Buchstaben, Ligaturen, Unendlichkeitszeichen. Ich habe mich auf die Suche gemacht, was das zu bedeuten hat und herausgefunden, dass das eine Chiffrierung ist, die Heidi Paris damals vorgenommen hat. Eine Chiffrierung des Satzes, der irgendwo in der Mitte des ersten Teils steht: »Das Gedächtnis kommt im Verhältnis zu den Zeichen, die es zu entziffern gilt, immer zu spät.«
Das ist im Kapitel über die Sekundäre Rolle des Gedächtnisses …
… eine sekundäre Rolle, die man auch eine sekundierende Rolle nennen könnte. Weil Deleuze doch sagt: Es gibt etwas, das wir bei Proust finden, eine Form der ursprünglichen oder ersten Suche nach Wahrheit und dann gibt es wiederum etwas, das wir in der Philosophie finden. Die Philosophie schafft ein Nachhinein, etwas, das man als weniger echt oder weniger dringlich bezeichnen könnte. Wie sehen Sie das?
Die Frage von »weniger echt« oder »weniger dringlich« würde ich erstmal ausklammern. Das ist eine andere Frage, die dann aber auch das Verhältnis von Kunst und Philosophie betrifft. Der erste Gedanke, der in diesem Zitat steckt und der in dem ganzen Kapitel über die sekundäre Rolle des Gedächtnisses entfaltet wird, ist grundlegender und hat eine andere Stoßrichtung. Deleuze interveniert in eine Proust-Lektüre, eine Proust-Tradierung, die ihn vor allem als Autor des Gedächtnisses und dieser verschiedenen Form der mémoire versucht hat zu rezipieren und festzustellen. Und damit als einen Autor der Vergangenheit, vielleicht sogar der Nostalgie. Mit der These, das alles, was die Recherche tut, eine Wiedergewinnung von etwas Ursprünglichem sei, das sich nur in Erinnerungs- oder Gedächtnisformen erreichen lässt. Damit ist er für viele und auch die meisten literarischen Anschlüsse an Proust, wie Nabokov und ähnliche, der Schriftsteller des Gedächtnisses. Die Provokation von Deleuze hier ist, zu sagen: Das ist falsch. Das Gedächtnis ist wichtig – aber immer sekundär.
Und wie Sie völlig richtig sagen, hat er dann diese Idee, dass es unterhalb der Ebene der Suche nach dem Gedächtnis eine andere, ursprünglichere Suche oder ursprünglichere »Begegnung« gibt, die in einem gewissen Sinn vor dem Gedächtnis liegt und ihm auch überlegen ist. Sodass der ganze Text gar keine Polung hin auf Gedächtnis und Vergangenheit hat, sondern umgekehrt auf eine Ursprünglichkeit, die eher eine Frage der Zukunft als des Vergangenen ist. Das ist eine ziemlich komplexe Idee, die zunächst kontraintuitiv ist und in Bezug auf Proust auch überraschend. Deleuze weiß das ganz genau. Er dramatisiert diesen Punkt das ganze Buch über, als ob Proust nicht doch der große Autor des Gedächtnisses wäre; denn er ist es natürlich... Und dann gibt es noch diese interessante Abgrenzung, dass die Philosophie tatsächlich eher Medium oder Instanz der Vergangenheit ist, während die Kunst aber nach vorne, in die Zukunft arbeitet und blickt.
Aber Deleuze macht den interessanten Punkt, dass die Gedächtnisfrage bei Proust selber im Dienste von etwas anderem steht. Und dieses andere zu bestimmen ist schwer. Die Frage des Ursprungs oder die Suche nach der Wahrheit ist nicht so leicht zu verstehen. Da hängt dann sehr viel an dem, was hier »Zeichen« oder »Erfahrung« heißt. Aber das Interessante ist hier wirklich, dass Deleuze behauptet, dass die Vergangenheit und ihre Wiedergewinnung in der Form des Gedächtnisses nicht Prousts eigentliches Thema ist. Es geht um etwas anderes. Die Kunst will etwas anderes, als das verlorene Glück der Kindheit wiederauferstehen zu lassen. Dabei hat man ja Proust genau so fast immer rezipiert (Stichwort »Madeleine«).
1. SCHRITT
Då‚ ©edæ窆ni‚ ∆øµµ† iµ
√e®ªæ¬†ni, Ω¨den
Ωeiçªen∞ die e‚ Ω¨
en†Ωiƒƒe®n ©i¬†∞ iµµe®
Ω¨‚πæ†.
Proust ist also ein Autor der Mémoire. Das Buch beginnt, indem Deleuze sagt, die Welt von Méséglise und die Welt von Guermantes seien weniger Quellen der Erinnerung als »Grundstoffe und Leitlinien einer Lehre«. Einer Lehre, die noch unbestimmt ist. Auch wenn beide, Deleuze wie Proust, schauen, was in der Welt der Erinnerung zu finden ist, geht es eben darum nicht. Es geht zunächst und eigentlich um Zeichen. Dieser Text ist auf seinen Vorderseiten eine Zeitstudie, eine Frage nach der Abfolge und dem Verhältnis der Zeiten und Zeitformen in der Recherche, auf seinen Rückenseiten ist er eine Zeichenlehre.
Ja, das ist richtig. Wenngleich das jetzt schon die These von Deleuze voraussetzt. Im Jahr 1964 war dies eine kritische Intervention: Dass das, was Proust hier in erster Linie inszeniert, keine psychologischen oder biographischen Fragen von Sich-schreibend-seiner-eigenen-Erinnerung-Vergewissern ist, sondern im Gegenteil eine gewissermaßen objektive, a-personale, a-subjektive Lehre von den Zeichen und ihren Beziehungen untereinander. In diesem Sinn gehört das ganz in die Konjunktur der strukturalistischen Semiotik oder Semiologie. Man könnte sogar sagen: Das ist einer der strukturalistischten Texte von Deleuze, an dem dieser eigentlich relativ orthodoxe Operationen rund um die Fragen »Was sind Texte?«, »Was tun Texte?«, »Was inszenieren Texte?« vornimmt. Auf eine Weise, wie er das in seinen späteren Schriften gar nicht mehr gemacht hat, obwohl das Zeitlichkeitsthema schon die späteren poststrukturalistischen Themen ankündigt. Dies sind Heidegger-Topoi, die auch bei Derrida wichtig sind und in den 60er Jahren eine enorm große Rolle in der Kritik des orthodoxen, formalistischen Strukturalismus spielen.
Die Deleuze-These lautet: Proust bietet uns nichts an, was eindeutige Verhältnisse zwischen Vergangenheit und ihrem Wiederkehren in der Erinnerungsform ergeben könnte, sondern er bietet uns ein komplexes Spiel von Zeichenverhältnissen, die sich gar nicht leicht nach dem Schema gegenwärtig versus vergangen klassifizieren lassen. Das Vergangene ist als Zeichen vollends gegenwärtig. Das, was uns als Zeichen an etwas anderes erinnert, ist kein Zeichen der Vergangenheit, sondern ein Gegenwärtiges, ein Präsentes und sogar Zukünftiges. Und das hängt bei ihm auch zusammen mit seiner Vorstellung von dem, was für ihn »Leben« heißt oder ist. Nämlich nichts, das aufbaut an vergangenem Leben, sondern das ein ständiges Hin-und-Her-Bewegen in den Zeitlichkeiten ist, in dem auch eine Vergangenhaftigkeit in eine Zukünftigkeit übersetzt wird. Die simple Ordnung der Abfolge-Zeit – vergangene Zukunft, präsente Gegenwart, zukünftige Futurität – wird in einem gewissen Sinn dynamisiert und als Zeichenhaftigkeit auf ein und derselben Ebene präsentiert.
Dies ist ein ziemlich komplexer Gedanke, der philosophisch erst einige Jahre später in den großen Hauptwerken von Deleuze eingeholt werden wird. Die Logik des Sinns [1969] und Differenz und Wiederholung [1968] erläutern dann genau diese komplexe Art von nicht-normal zeitlicher Zeitlichkeit, die hier erstmals und ein bisschen leichthändig erläutert wird, als eine Frage von Zeichenbeziehungen versus eindeutige Zeitbeziehungen.
2. SCHRITT
dås ©edæ窆nis ∆øµµ† iµ
√e®ªæ¬†nis zu den
zeiçªen∞ die es zu
en†ziƒƒe®n ©i¬†∞ iµµe®
zu sπæ†.
Im vierten Kapitel, das wir schon angesprochen hatten, in »Die sekundäre Rolle des Gedächtnisses«, schreibt Deleuze: »Es ist offenkundig, dass dem willkürlichen Gedächtnis etwas Wesentliches entgeht: Das Sein der Vergangenheit an sich. Es tut so, als ob die Vergangenheit sich als solche konstituiere, nachdem sie gegenwärtig gewesen war. Es müßte also eine neue Gegenwart erwartet werden, damit die vorhergehende vergehe oder vergangen würde. Doch auf diese Art entgeht uns das Wesen der Zeit. Denn wenn die Gegenwart nicht zugleich vergangen und anwesend wäre, wenn der gleiche Augenblick nicht mit sich als gegenwärtigem und vergangenem koexistieren würde, würde er nie vergehen, niemals würde eine neue Gegenwart ihn ersetzen können.« Was bedeutet das für dieses Problem?
Das ist schwierig zu entziffern, auch philosophisch-systematisch. Und philosophiegeschichtlich würde man die ganzen Subtexte, die da enthalten sind aufschließen müssen – das ist zur Hälfte Freud und zur Hälfte Bergson. Und auch die Unterscheidung von mémoire volontaire und mémoire involontaire, die mit dem »willkürlichen Gedächtnis« übersetzt ist, spielt hier auf jene Bergson-Problematiken an, die bei Proust (der mit Bergson ja sogar um zwei Ecken verwandt war), eine enorm große Rolle einnehmen, ohne aber, dass er das theoretisch ausgearbeitet hätte, auch wenn die Verweise und auch die Referenzen alle da sind und auch die Tiefe des Problems komplett gesehen ist.
Deleuze gibt hier im Prinzip eine elliptische oder sehr kondensierte Variante des Gedankens, dass die Vergangenheit auf keinen Fall in sich abgeschlossene Zeit ist, sondern das Verhältnis zwischen Gegenwart und Vergangenheit immer dynamisch bleiben muss, damit überhaupt eine Gegenwart auf eine Vergangenheit folgen kann. Und in diesem Sinn, ist die Vergangenheit nicht abgeschlossen, sondern wird gemacht und konstituiert in der Gegenwart. Und das ist ein Paradox: Dass die Vergangenheit nicht vergangen ist, sondern erst vergangen ist, wenn sie in der Gegenwart zur Vergangenen gemacht wird. Wir hätten gedacht, dass die Vergangenheit durch ihre Abgeschlossenheit definiert wird. Wir hätten gedacht: Vergangen ist, was nicht anders sein kann als so, wie es war. Während hier aber der Bergson‘sche Gedanke – dass sich die Vergangenheit erst in einer Gegenwart konstituiert, für die dieses Vergangene dieses Vergangene wurde – tatsächlich unterschrieben wird.
3. SCHRITT
dås ©edæçªtnis ∆ømmt im
√erªæ¬tnis zu den
zeiçªen∞ die es zu
entziffern ©i¬t∞ immer
zu sπæt.
Dieser paradoxe Gedanke folgt einem anderen Zeitbegriff als dem des Zeitstrahls oder abgeschlossenen Zeitphasen. Die Deleuze-These im gesamte Buch lautet: Genau so stellt sich Proust das Leben vor. »Leben« ist nicht der Rückbezug auf ein Vergangenes, das passiert ist; so ist die Recherche keine Biografie. Nein, das Schreiben konstituiert vielmehr, was war. Das Vergangene wird gemacht und ist in diesem Sinn wie das Gedächtnis, so das Zitat vorhin, sekundär. Das Gedächtnis ist nicht entscheidend bzw. es ist nicht das, was definiert, worüber geschrieben wird. Das Schreiben entscheidet darüber, was gewesen sein wird. Und damit ist Proust ein Denker, wenn man so will, für den die Vergangenheit das geschaffene, veränderliche Objekt des Schreibens ist. Und nicht sein Anlass oder gar sein Thema.
Philosophie oder Kunst?
Und damit ist doch verständlich, warum sich Deleuze so sehr für Proust interessiert. Denn der Romans ist dann in seiner Konsequenz gar nicht so sehr so verschieden von dem, was die Philosophie versucht. Roman und Philosophie sind Formen des Ordnens oder Formen des Verstehens, auch in einem Sinne wie Deleuze das teilweise hier meint, des Nachhineins, nur eben auf ganz verschiedene Weisen. Sie hatten eingangs gesagt, die Kunst werde noch wichtig. Es ist keine große Volte festzustellen: Wenn Deleuze von Kunst, im Gegensatz zur Philosophie, spricht, dann meint er natürlich auch die Literatur. Und dann lesen wir Passagen wie die folgende: »Worin liegt die Überlegenheit der Zeichen der Kunst über alle anderen? Darin, daß alle anderen materiell sind. Materiell sind sie zunächst durch ihre Aussendung, sie sind zur Hälfte verborgen in dem Gegenstand, der sie trägt. Sinnliche Qualitäten, geliebte Gesichter sind immer noch Materie. [...] Allein die Zeichen der Kunst sind immateriell.« Was wir als Erinnerung beschrieben haben, als die Zeit, die dort beschrieben wird, das hat etwas Stoffliches, hat Materialcharakter. Und damit können wir auf zwei Weisen umgehen: So wie die Philosophie oder so wie Proust.
Das ist richtig. Auch hier gibt es eine Polemik: Man hätte gedacht, die Rede von den Essenzen und auch die Rede vom Immateriellen würde der Philosophie zugeschlagen, während der Kunst und der Literatur der Bereich der Sinnlichkeit und der Singularitäten zugeteilt wird, ganz klassisch also. Die Kunst bleibt gebunden an Sinnlichkeit. Erst die Philosophie und, in gewisser Weise, die Religion reinigen – immaterialisieren – diese Arten von Eindrücklichkeiten. Deleuze sagt aber das Gegenteil. Deleuze zoomt auf die Passagen hin, in denen Proust philosophisch ist, in denen es Anklänge an Schopenhauer gibt, an Leibniz. Dann gibt er eine starke, ultraphilosophische Interpretation dessen, was da bei Proust steht. Er behauptet, die Kunst, die dieser Roman ausdrückt, ist selber eine des Aufführens und Festhaltens von Essenzen. Aber diese sind keine Abstraktionen, keine Allgemeinheiten. Und dennoch sind sie immateriell. Das Intuitive daran ist: Die Literatur ist tatsächlich vollständig immateriell. Das Buch ist nur insofern ein Ding, als es nicht zeichenhaft ist. Einen Gedanken zu schreiben, auszusprechen, zu singen, zu dichten – das ist die ultimative Immaterialisierung. Etwas in Kunst zu überführen, beraubt die Sache seiner sinnlichen Form. Was daran Kunst geworden ist, hat im selben Maße aufgehört, Sinnlichkeit zu sein.
Deleuze denkt, dass die Recherche das ultimative Kunstwerk ist, weil es so lang und so umfassend und alles umgreifend angelegt ist. Es ist die totale Transfiguration von Sinnlichkeiten in ihre Essenzen. Davon gibt es bei ihm – ein antiplatonischer Zug – unendlich viele. Diese Essenzen sind also eines keinesfalls sinnlich-materiell. Die Kunst ist etwas ganz anderes als die Welt. Anders als die anderen Diskurse und Ordnungssysteme, die versuchen, die Dinge zu fixieren. (Die Philosophie ist einer dieser Wege. Und das persönliche Leben ein anderer.)
Die Kritik an der Philosophie bewegt sich aber nicht nur auf der Ebene von Strukturierungsweisen. Es geht Proust auch darum, dass es der Philosophie an Notwendigkeit fehlt. Darum, dass die Kunst zur Kunst gezwungen wird. Es geht also um die Eindrücklichkeit der Erinnerung. Die Kunst ist für die Erinnerung empfänglich. Nicht aber die Philosophie.
Richtig. Der Begriff des »Eindrucks« ist hier entscheidend. Neben dem der »Begegnung«. Die Formel des »Gezwungenwerdens« ist der Punkt, der im allerletzten Teil des ersten Teils des Textes die Literatur von der Philosophie abtrennt. Weiter vorne im Buch – ein wenig verwirrend – gibt es eine affirmierende Paraphrase von Prousts eigener Ablehnung des Philosophischen als einer falschen Form der Abstraktion. Dort ist Deleuze noch etwas zaghaft und paraphrasierend. Er lässt Proust in diesen Zitaten seine Kunstmetaphysik ausbreiten, während seine eigene Reformulierung dieser Kritik viel weiter hinten kommt.
Es ist, wie Sie sagen: Die Deleuze-These lautet, dass die Philosophie mit Essenzen handelt. Auch sie ist eine Zeichenlehre. Aber das Dealen mit Essenzen, das von der Kunst betrieben wird, ist ein anderes. Eines, das notwendig oder erzwungen ist. Prompted by something. Ins Leben gebracht in einem Akt, der gewaltsam und nicht-freiwillig ist. Dass die Kunst an einer bestimmten Stelle beginnt und dieses oder jenes beschreibt und versucht es auf Essenzbeschreibungen zu bringen – all das ist niemals frei, sondern immer erzwungen durch etwas, das vorgefallen ist, Eindruck gemacht hat. Die Recherche ist also ein erzwungenes Buch. Ein Buch, das jemand schreiben musste, der Dinge erlebt hat und ihnen nacharbeitet. Nicht, um sie wiederzugewinnen, sondern um sie zu übersetzen in etwas, das sie nicht selber waren. Wahrheiten oder Bilder von Denken, die erzwungen sind von etwas, das nicht selber Denken ist, sondern Materialität, Erfahrung, Körperlichkeit, Kindheit, unwillkürlicher Geist.
Darin liegt eine harte Kritik der Philosophie, die eben dazu nicht in der Lage ist, weil sie sich selber als viel zu frei und viel zu selbstständig wähnt gegenüber diesem Anderen, das das Denken eigentlich erzwingt. Aber dies ist eine Illusion. Dieser Schein der Selbstständigkeit der Philosophie wird mit der Waffe der Literatur angegriffen. Deleuze wird später eine Form von Philosophie ausarbeiten (oder von ihr träumen), die genau das auch sein kann: ein Denken der Heterogenität, das das, was ihm vorausgeht und was es nicht einholen kann, was es nicht ist, aber was es zwingt zu denken, artikulieren kann.
4. SCHRITT
dås ©edæchtnis ∆ømmt im
√erhæ¬tnis zu den
zeichen, die es zu
entziffern ©i¬t, immer
zu sπæt.
Der Schein der Autonomie
»Der Irrtum der Philosophie liegt darin, daß sie in uns einen guten Willen zum Denken voraussetzt, einen Wunsch, eine natürliche Liebe zum Wahren. Daher gelangt die Philosophie nur zu abstrakten Wahrheiten, die niemanden in Verlegenheit bringen und zu einer Veränderung veranlassen. ›Les idées formées par l’intelligence pure n‘ont qu‘une vérité logique, une verité possible, leur election est arbitraire.‹ Sie bleiben willkürlich, weil sie aus dem Verstand geboren sind, der ihnen nur Möglichkeit mitgeben kann, und nicht aus einer Begegnung oder einer Gewalt, die ihnen Authentizität sichern würde. Die Ideen des Verstandes haben nur den Wert ihrer expliziten und daher konventionellen Bedeutung. Es gibt nur wenige Vorstellungen, auf denen Proust derart wie auf dieser beharrt: Die Wahrheit ist nie Produkt eines vorgängigen guten Willens, sondern das Ergebnis einer Gewalteinwirkung im Denken. Die expliziten und konventionellen Bezeichnungen gehen niemals tief [...]«, schreibt Deleuze im zweiten Kapitel, »Zeichen und Wahrheit«. Meine Frage dazu ist für mich permanent: Deleuze ist doch schließlich ein Sozialphilosoph. Sie ebenso. Proust aber ist Schriftsteller. Warum sollte er, warum sollten Sie, es Proust angesichts aller Kritik nicht gleichtun? Warum nicht Philologie oder Literaturwissenschaft, warum nicht dichter an den Zeichen? Oder anders gesprochen: Warum denn Philosophie?
Das ist eine gute Frage. Deleuze-Interpreten vollziehen komplexe Tänze um die Beantwortung der Frage, wie sich Philosophie und Kunst und Literatur bei Deleuze genau zueinander verhalten. Sie kommen immer wieder auf den Punkt, dass Deleuze selber auch in seinen Beschreibungen des Ästhetischen und Literarischen genau das formuliert, was offensichtlich für ihn das wirkliche, richtige, gute Denken oder Philosophieren ausmacht. Das ist der Grund, weshalb manche Texte den Eindruck erwecken, als wäre Literatur eigentlich die bessere, beste Philosophie. Manchmal sieht es so aus, als könnten die Schriftsteller etwas formulieren, aber nicht wissen, das die Philosophie zwar weiß, aber nicht formulieren kann. Eine wünschenswerte Art von Denken wäre eine, die diesen Unterschied rückgängig macht, obwohl sie ihn die ganze Zeit setzt.
Deleuze hat, wie Platon, gedacht, dass die Philosophie immer gegen die Kunst und die Literatur kämpft. Aber gegen Platon gewandt hätte er gesagt, dass die Philosophie den Kampf verlieren muss, aufgeben, sich von der Kunst darüber belehren lassen muss, was sie nicht kann. Proust werden Philosopheme zugeschrieben, die man in rein philosophischer Sprache – ohne Bezug zu literarischen Figuren und Zeichen – vielleicht gar nicht vollständig formulieren kann. Deleuzes Werk selber exemplifiziert eine solche Form des Unreinen, des sich mit dem Literarischen Einlassens, vielleicht sogar gegenüber dem Literarischen Kapitulierenden.
Für uns ist das interessant. Deleuze war Sozialphilosoph, sagen Sie. Er hätte das für eine bürokratische Zuschreibung gehalten. Viele von uns sind, im akademischen Sinn, »normale« Philosophen. Deleuze fordert uns heraus, indem er darauf hinweist, dass der Primat der Philosophie zur Artikulation dessen, was interessant ist, was die Essenzen betrifft, gar nicht besteht. Gäbe es ihn, müsste man ihn der Literatur abtreten und danach eine philosophische Sprache finden, die ähnliche Gesten vollziehen kann. In diesen Passagen sehe ich eine solche Geste, wenn er sagt, die Literatur beginnt da, wo sie erzwungen ist, aber danach eine Art von Unvermeidbarkeit, von Zwingendem im Ausdruck erreicht. Und genau das gelingt der Philosophie, die immer glaubt, sie wäre nicht erzwungen, nicht. Der Schein der Autonomie, die Illusion der Souveränität, die das Denken in klassisch-philosophischer Form hat, hindert es daran, das Denken oder die Philosophie wirklich zu denken. Denn wirkliches Denken wäre: gezwungenes, erzwungenes Denken, man könnte aus sagen: Denken aus Erfahrung (hegelianisch gesprochen, Deleuze hätte diese Übersetzung natürlich gehasst). Deswegen zeichnet sich hier eine Form von »schwachem«, heteronomem Denken ab, das so aussieht, als sei es keine Philosophie mehr. Aber eben nur, weil wir uns Philosophie für gewöhnlich anders vorstellen als rein oder autonom. Dies ist also auch eine Skizze minoritärer Philosophie, anderer Philosophie, subalterner Philosophie. Ein Denken, das zulassen kann, nicht Herr im Hause zu sein, das immer auch unterworfen ist, Subjekt von etwas sein, das es nicht bemeistern kann. Dies erscheint mir, auch mit Blick auf die Debatten, an denen wir im Moment beteiligt sein, wichtig und es könnte sich lohnen, diese Motiv wieder einmal aufzugreifen, dass die Philosophie nicht über allem schwebt.
5. SCHRITT
dås gedächtnis ∆ømmt im
√erhä¬tnis zu den
zeichen, die es zu
entziffern gi¬t, immer
zu sπät.
Also wäre der eigentliche Schlusssatz dieses ersten Teils nicht der kursivierte, der polemische »Es gibt keinen Logos, es gibt nur Hieroglyphen«, sondern der vorangehende, der nicht rhetorisch ist. »Der Verstand kommt immer nachher, er ist gut, wenn er nachher kommt, er ist nur gut, wenn er nachher kommt.« Das Bekenntnis, dass die Philosophie dann gute Philosophie ist, wenn sie Anderem, Dringlicherem, den Vortritt lässt.
Dies ist auf jeden Fall richtig, aber man darf nicht vergessen: Der gesamte Text bringt die Ordnung zwischen Vorher, Jetzt, und Nachher durcheinander. Die einfache zeitliche Ordnung ist eine falsche philosophische Konstruktion, die Deleuze mit Bergson und Proust aufrüttelt. Die logische Komponente scheint mir hier wichtiger als die zeitliche zu sein. Unsere graeco-latinisierten Sprachen blenden gern die zeitlichen und die logischen Vorränge komplett ineinander. Die Rede von Ursache, Wirkung, Folge und Konsequenz ist dafür ja der beste Ausdruck. Der Grundgedanke, den Sie aufwerfen, ist hier wichtig. Die Philosophie darf keine Vorrangsdisziplin sein. Das wirkliche Denken ist eines, das sich einem Auslöser, einem Impuls verdankt, der ihr äußerlich heterogen und vorgängig ist. Ein Denken, dass das nicht zulassen kann, ist »nur« Philosophie – im schlechten Sinne, die Idee, es gäbe die Ideen und Essenzen in einem überzeitlichen Ideenhimmel. Während die Philosophie, wo sie wirklich interessant, aber leider auch unrein und unsouverän wird, ein Denken ist, das sich von Dringlichkeiten – nicht-philosophischen – von realen, politischen, amourösen, körperlichen Impulsen, treiben, antreiben und auslösen lässt, und sie danach in die Form des Denkens, in Zeichenverhältnisse bringt, wo dann etwas zu sehen, zu lesen, zu verstehen ist. Dies ist eine anspruchsvolle Vorstellung dessen, was Philosophie sein könnte, auch wenn sie so aussieht, als sei sie eine, in der die Philosophie gegenüber einem ihr Anderen kapituliert.
6. SCHRITT
das gedächtnis kommt im
verhältnis zu den
zeichen, die es zu
entziffern gilt, immer
zu spät.
µå®†⁄~ ‚åå® ist ein deutscher Philosoph. Er studierte Philosophie, Psychologie und Volkswirtschaftslehre an der Freien Universität Berlin. 2007 erscheint seine Promotionsschrift Genealogie als Kritik. Geschichte und Theorie des Subjekts nach Nietzsche und Foucault (Campus), sechs Jahre später die überarbeitete Habilitationsschrift Die Immanenz der Macht. Politische Theorie nach Spinoza (Suhrkamp). Martin Saar ist Teil des Instituts für Sozialforschung und gehört als Inhaber der Professur für Sozialphilosophie der Goethe-Universität Frankfurt zur nunmehr 4. Generation der Frankfurter Schule. In der Sternstunde der Philosophie des SRF sprach er jüngst zur »Wirkung der Macht«.
Text: Gilles Deleuze, Proust und die Zeichen (Berlin: Merve 1992)
Produktion: ªø@µ–¨∑€ ∫¨®©€µå~~ ¨~∂ ∆ø~‚†å~†⁄~ ‚窜~ƒ€@∂€®
Hat Ihnen dieser Text gefallen? PRÄ|POSITION ist als gemeinnütziges Projekt der »Förderung von Kunst und Kultur« verpflichtet. Das Kollektiv arbeitet allein für den Text. Doch ohne Mittel kann auf Dauer selbst Kultur nicht stattfinden. Werden Sie Freund:in von PRÄ|POSITION und unterstützen Sie uns über PayPal, damit auch kommende Texte lesbar bleiben.