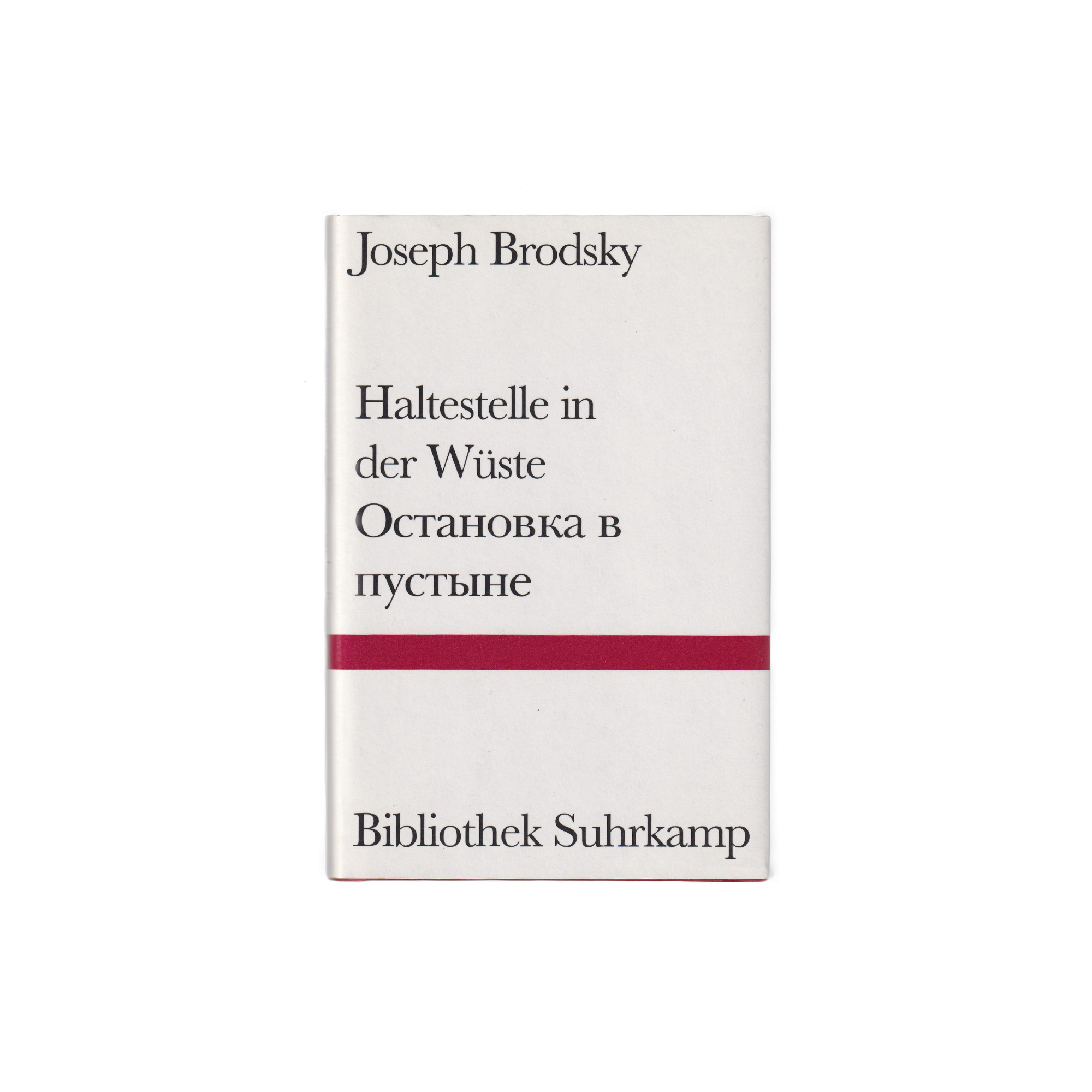#58 Joseph Brodsky: Große Elegie an John Donne
Totenstille wäre unerträglich für die Lebenden. Wäre, denn es gibt sie nicht. Es gibt: den Camera silens, einen dunklen, schallisolierten Raum. Einen Ort der Folter, der sogenannten »Weißen Folter«, denn die Methode ist unblutig, hinterlässt keine Schrammen oder Hämatome. Die Gefolterten werden innerlich zerrüttet durch die Weltlosigkeit des Vakuums, in das sie eingeschlossen sind. Auch hier aber, selbst hier, hört man: wie das Herz schlägt, wie das Blut zirkuliert. John Cage nannte die Stille deshalb »die Abwesenheit von beabsichtigten Geräuschen«. Die Stille also als das, was klingt, wenn aller menschliche Aufwand, sie zu durchbrechen, eingestellt wird. Stille verstummt nicht. In seinem »Vortrag über das Nichts« von 1959, sagt er: »Wir brauchen nicht diese / Stille zu fürchten. – / wir könnten sie lieben.« Wie ein heilsames akustisches detox, eine Entgiftung der Ohren, des Kopfes, des Körpers.
So instruktiv sollten wir keine Lyrik lesen. Oder vielleicht doch? Das Gedicht Joseph Brodskys eignete sich dazu. Die »Große Elegie an John Donne«, erschienen in deutscher Übertragung in dem passenderweise Haltestelle in der Wüste betitelten Band, ein Jahr nach dem plötzlichen Tod des russisch-US-amerikanischen Lyrikers und Nobelpreisträgers. John Donne schläft darin ein. Mit ihm die Welt um ihn herum: Der Teppich erst, die Schüssel, das Zimmer, schließlich ein Schiff, die Wälder, sogar die Grammatik, sogar die Feindschaft schläft. Brodskys Elegie liest sich unter dem Eindruck der pandemischen Gegenwart wie ein poetischer Vorgriff, der uns sodann ganz physisch berührt.
Ein Monolog deshalb mit Christian Reiner, einem Sprecher an der Schwelle von Sprache und Musik. Der dieses Gedicht und unsere stillgelegte Welt zugänglich macht – mit seiner Stimme, dem Instrument der Stille.
Wie ein Wanderer geht Christian Reiner gedichteinwärts. Er arbeitet sich nicht durch die Landschaft, noch eilt er. Das Gedicht ereignet sich ihm. Nur so lässt sich erklären, wie er in einen offenen Dialog mit ihm eintreten kann. Mit seiner Interpretation der Turmgedichte Friedrich Hölderlins ist er als Sprecher für literarische Sonderfälle bekannt geworden. Auf dem Album sind kurze, verdichtete Sequenzen zu hören, keine länger als vier Minuten, die meisten kürzer als zwei. Die Stille – gleichwertiges Element der Tracks wie die Verse selbst.
Bei einem Auftritt im Herbst 2020 dieser Eindruck: Ein Autorengespräch ist vorüber, Reiner ist als Performance angekündigt. Noch in der Zwischenpause schleicht er auf die Bühne, zieht sich die hellblauen Sneaker aus, füllt langsam und still die Bühne, bis die Pause sich irgendwann wie von selbst einstellt und Reiners Präsenz in die Rezitation übergeht. Unmittelbar bevor Reiner beginnt, war es still gewesen, doch hörte man die Stille nicht. Während seiner Performance wird die Stille immer lauter: Das Knarren der Balken und Stühle, das ungleichmäßige Atmen des Publikums, die Nachbarin schluckt. Plötzlich beginnt die Stille zu klingen, für die man zuvor taub gewesen war. Nach der Veranstaltung erzählt Reiner, wie er Hölderlins Gedichte immer wieder neu liest, auch an diesem Abend. Und wie die Brodsky-Aufnahmen zustande kamen, die 2017, fünf Jahre nach Hölderlin, erschienen. Mit Brodsky teilt er einen praktischen Zugang zur Lyrik. Er wollte, dass Gedichtbände an Tankstellen verkauft würden. Gedichte sind lebensnotwendig, mindestens für ihn. Zur Zeit arbeitet er an einer Vertonung von Samuel Becketts poetischem Prosastück »Bing«.
Der Anfang von dem Text »Bing«: »Alles gewusst alles weiß«. Mit diesem wissen und gewusst und die Farbe Weiß, die dann auch noch alles ist. Das klingt wie ein Glückstreffer! Aber der Satz ist im Englischen weit unspannender. Und dann gibt es ja dann auch noch eine andere Sache in der englischen Fassung: Dort heißt das nicht Bing, sondern Ping. Und dieses Ping kommt als Wort immer wieder irgendwo vor. Und im Deutschen ist das übersetzt mit zwei verschiedenen Sachen: Einmal mit Bing und einmal mit Hopp. Es passiert dadurch ein anderes Gedicht.
»Alles gewusst alles weiß nackter weißer leib ein meter beinahe aneinander genäht.« Allein hier merkst du schon: Durch das Deutsche bekommst das etwas Rhythmisches. Das ist für mich alles dann plötzlich: Ah, hier geht's auf durch die deutsche Sprache. Jetzt verstehe ich das. Das ist wie so ein Rhythmusgebilde. Und das passiert bei mir im Englischen nicht. Wobei ich natürlich auch des Englischen nicht so mächtig bin und die ganzen Zweideutigkeiten nicht so gut heraushören kann.
Die Aufmerksamkeit, die ich eigentlich dem Instrument gebe, gebe ich dem Instrument der Stille. Das kennt man von der Improvisation. Dort ist es ja auch so, dass man nur als Anfänger die ganze Zeit spielt. Später lernt man auch irgendwann mal, das einzuteilen und in der Freiheit, wenn man doch eigentlich immer spielen dürfte, einfach mal den Schnabel zu halten und hinzuhören. Das ist ja jetzt auch so. Weißt du, das ist ja jetzt auch so – es entstehen ja jetzt immer kleine Pausen hier, so wie das jetzt, kleine Pausen –
In dieser kleinen Pause mache ich meinen Entwurf, was ich als nächstes sagen muss, denn ich weiß ja jetzt noch nicht, was ich dir sage. Und du hörst in dieser Zeit eben zu, was ich gesagt habe und lässt das sinken. Das hat auch einen Namen: Das ist die sogenannte Pause des Hörverstehens. Je besser das Redner beachten, desto besser wird das auch zu verstehen sein. Es funktioniert ja einfach nicht ganz so schnell wie man oft denkt. Klar habe ich verstanden, was du sagst, aber ich habe noch keine Bilder – und je mehr du mir Zeit lässt, desto klarer werden die Dinge. Und je mehr wir fahrig und schnell miteinander sprechen und der eine dem anderen die Pause nicht lässt, desto weniger hat man vielleicht davon. Nicht nur vielleicht, sondern man hat weniger davon. Nur manchmal ist dieses wenige ja auch gut.
Ich lese eigentlich wenig Prosa. Ich will mich jetzt hier nicht als jemanden hinstellen, der so tut, als wäre er ein bisschen Kaspar Hauser und ich kenne kein Buch oder so. Aber ich lese Bücher eigentlich nicht, also Prosa. Sehr selten. Wenn ich mal einen Auftrag habe: Ich habe für die Blindenbücherei Baden-Württemberg viel gearbeitet und habe auch einige Hörbücher in diesem Zuge aufgenommen. Aber eigentlich haben mich nie diese Bücher interessiert, weil das kann ich oft gar nicht wahrnehmen. Also mir ist das unbegreiflich, wie es Leute gibt, die im Urlaub an einem Tag ein Buch lesen. Das verstehe ich nicht. Das geht mir absolut nicht in den Kopf. Das könnte ich nie. Das wäre eine große große Arbeit und das wäre viel mehr Anstrengung, als dass es Urlaub sein könnte. Und im Urlaub nehme ich manchmal ein, zwei Gedichte mit. Das reicht dann für drei Wochen.
Ich bin eher ein Video-Kind und bin in dem Comic-Zeitalter aufgewachsen. Ich habe als Kind nicht besonders viel Bücher gelesen. Ich habe das meiste im Fernsehen gesehen. Erst später haben mich die Gedichte interessiert und die natürlich auch aus dem Grund, weil die so kurz sind, weil man die immer wieder lesen kann. Und weil du bei einem Gedicht immer wieder etwas Neues hörst – selbst bei einer Einsprechung. Und so geht's mir auch. Wenn ich jetzt heute nochmal den Brodsky mache, dann entdecke ich immer noch Sachen, die mir neu sind da drin. Auch bei Hölderlin: Das sind ja oft nur Achtzeiler, aber diese Achtzeiler, da steckt so viel drin wie in manchen Büchern nicht. Und das ist das, was mich interessiert und auch diese Freiheit zu haben von einem Gedicht. Eigentlich erzählt dir ja bei einem Gedicht auch niemand, wo es anfängt und wo es aufhört. Du kannst ja auch hinten anfangen oder in der Mitte anfangen und lies dich halt erst nach rechts oben oder nach links unten oder sowas. Und das ist diese Freiheit! So hat mich überhaupt erst das geschriebene Wort eigentlich bekommen. Daher war das sowieso für mich eine große Neuerung, etwas langes zu machen. Ein 20-Minuten-Gedicht – das war bisher nicht meine Sache.
Auch bei Hölderlin habe ich über »Brod und Wein« nachgedacht. Aber dann dachte ich, das ist zu viel, da weiß ich ja nicht mehr, was ich gesagt habe, wenn ich in der Hälfte bin. Brodsky ist für mich das Längste, was ich jemals gemacht hab. Was jetzt natürlich mit manchen Beckett-Texten auch so ist, mit denen ich mich beschäftige. Kurzgeschichten haben mich auch schon immer interessiert. Das heißt, abgeschlossene literarische Werke, die ein paar Seiten haben. Ich habe viel Daniil Charms anfangs gemacht mit diesen absurden Kurzgeschichten. Das geht. Aber eben diese langen Erzählungen, das ist immer so – das würde ja ewig dauern, bis ich mich da mal durchforste. Denn bei einem Gedicht kannst du jedes Wort auf die Waagschale legen und so ist das auch. Jedes einzelne Wort bei Brodsky hat mich wieder beschäftigt. Was bedeutet das? Was heißt das? Warum? Wie? Was hieß das in der Zeit? Weil man liest natürlich ganz schnell mal immer über so Worte drüber. Aber es macht mir halt Spaß, jeden einzelnen Baustein wieder neu zu beleuchten.
Die Dichtung hat natürlich auch noch die Musikalität, das ist vielleicht auch noch ein ganz großes Element, denn in der Dichtung steckt ja auch noch etwas anderes als diese pure Erzählung. Für mich hat die Prosa immer eine Geschichte erzählt. Ja, da war ein König, der hat das gemacht und dann ist das passiert. Das hat mir aber eigentlich immer besser in der mündlichen Übertragung gefallen oder vielleicht sogar im Film.
Und bei einem Gedicht steckt ja nochmal ganz viel Anderes drin. Da ist der Rhythmus. Da ist schon eine vorgegebene Sache, wie mein Instrument gestimmt werden soll. Wir haben ja 15 unterschiedliche Vokale, das heißt 15 unterschiedliche Vokalstellungen, die mein Mund einnimmt. Und das steht schon alles da: ob der lang ist, ob der kurz ist, welche Konsonanten vorkommen, ob viel wewewe vorkommt zum Beispiel, oft bei fließenden Sachen, oder ob die ganze Zeit Jetzt blitzt’s und sowas vorkommt.
Das hat eine Musikalität. Und diese Musikalität interessiert mich immer bei dem, was ich mache. Ich komme ja eigentlich auch aus dem Gesang, also aus dem ganz normalen Bandgeschehen als Jugendlicher. Und da war dieses Musikalische immer schon wichtig und besonders auch bei uns, die wir da in dieser Zeit noch viel englischsprachige Musik gehört haben, oft ohne sie zu verstehen. Als Kind oder als Heranwachsender hörst du irgendetwas und du hast keine Ahnung, aber du machst deine eigene Sprache. Aber die Musikalität ist eben da. Und mich haben diese musikalischen Aspekte von Stimme und Sprache schon immer ein wenig mehr interessiert als die Erzählung.
Das Gedicht »Große Elegie an John Donne« ist in der Suhrkamp-Übertragung von »Kaempfe/Ost«, Alexander Kaempfe und Heinrich Ost, auf den 7. März 1963 datiert. Joseph Brodsky ist zu diesem Zeitpunkt 23 Jahre jung. Rückblickend sagt er, ihn habe die Vorstellung bewogen, ein Gedicht wie eine Szene im Film zu schreiben, »wie wenn ein Stein in einen Teich fällt und sich die Kreise ausbreiten«. Der Erzähler fokussiert zunächst den Protagonisten und dreht anschließend Vers für Vers in die Totale:
John Donne ist eingeschlafen. Alles schläft.
Gemächer, Betten, Wände, Bilder schlafen,
Tisch, Teppich, Schlösser schlafen, Tür, Büfett,
Gardinen, Riegel, Kerzen, Mantelhaken.
Nichts, das nicht schliefe […]
Irgendwann schläft Donne, schlafen die Gegenstände in seinem Zimmer, aber auch die Flüsse, sogar die Sprache ruht.
Es schlafen Reime, Bilder, starke, schwache.
Die Laster haben sich in sich gekehrt.
Die Sünden liegen im skandierten Schlafe.
[…]
Die Zeile schläft. Der Jambus wölbt sich hoch.
Links, rechts, wie Wächter schlafen die Trochäen.
[…]
Die Laster schlafen. Gut und Böse schlummern.
Auch die Propheten schlafen. Schnee fällt weiß
Und sucht sich im Raum nach kleinen schwarzen Punkten.
Im Schlaf liegt alles. Pult. Bibliothek.
Der Schnee nur rieselt leis auf Zaun und Pflock.
Sonst ist kein Laut mehr auf der Welt zu finden.
Hier endet der längere erste Teil des Gedichts. Dann der Umbruch: »Doch da! Du hörst es?«. Der Rhythmus ist gebrochen, der Stein schlägt keine Wellen mehr. Ein zweiter Teil beginnt. Fragen folgen auf Fragen; die Angelegenheiten verunklaren sich. Wer spricht da? Welche Fragen dringen durch die Stille? Ein Traum von John Donne? Eine Einbildung? Der Tod? Die Elegie wird stiller, noch schwermütiger. Die Verse genügen sich selbst, bis sie schließlich ins Weiß übergehen und völlig verschwinden.
Es hat erst einmal so begonnen, dass ich diese Sprache hören musste. Ich musste dieses Russisch hören. Ich kann kein Russisch. Ich weiß ein bisschen, wie das klingt, aber ich habe keine Ahnung davon. Wir haben dann Juri Smirnow gefunden, der auf der CD auch den Titel liest und mit dem ich mich erst einmal getroffen habe. Er ist ein ehemaliger Konzertpianist. Und er hat mir das dann in Gänze vorgetragen. Und dann habe ich diesen Ton mal gehört.
Dann habe ich die Melodie gehört und habe aber auch gemerkt, dass das mit der Übersetzung ins Deutsche unmöglich ist. Man wird nicht an die Sprachmelodie herankommen. Das ist im Russischen ja quasi ein einziges Jambenfest, das da gefeiert wird.
Dada, da, da, da, da, dada, da, da, da, da und das geht dahin.
Sodass man selbst fast schon so ein bisschen einbummelt und einschläft. Das fällt im Deutschen natürlich weg. Das Deutsche ist melodiös, aber die Melodie ist nicht so wichtig. Und im Russischen sehr wohl. Da ist immer dieser Jambus drin. Und das kann man nicht übertragen. Und natürlich hab ich auch mal den einen oder anderen affigen Versuch gemacht. Aber das ist Quatsch. Es macht einfach keinen Sinn, weil die Silben im Deutschen anders sind. Ich kann nicht aus einer kurzen Silbe plötzlich eine lange machen – und dann ist es nicht mehr gesagt, sondern es ist mehr gesungen. Und dieses Singen geht aber dann nicht mehr einher mit dem Sagen. Es gibt ja einige Sprachen: Italienisch, Russisch, da ist das ja fast so! Und in diesem Fall hat mir die Stille wiederum sehr geholfen, dass das dadurch eben nicht die Melodie ist, sondern die Melodie in dem Kopf des Zuhörers durch die Bilder entsteht.
Jedes Element, das da schläft, der Tisch, der Boden, der Teppich, der bekommt seinen Platz. Dass das also quasi nicht nur heißt, der Teppich, sondern der Teppich. So, und schon wenn ich darauf nichts sage, wird das in dem Kopf des Zuhörers sein Teppich. Und jetzt wird es interessant, finde ich. Denn dann ist das nicht mehr meine Geschichte, auch nicht mehr die von Brodsky und auch nicht mehr die vom Übersetzer oder der Übersetzerin – sondern in erster Linie die des Zuhörers.
Die größte Schwierigkeit für mich dabei war eigentlich die Übersetzung, weil ich arbeite normalerweise mehr mit der deutschen Sprache, also meiner Sprache. Auch, weil ich natürlich etwas geübter bin, in dieser zu denken. Für mich ist ein Fenster was ganz anderes als ein window. Dann ist es natürlich oft auch so, dass in den Übersetzungen, besonders in den deutschen Übersetzungen, eine bestimmte Künstlichkeit hinzugefügt wird, die es im Original gar nicht gibt.
Wir haben noch weitere Sachen gesucht, die auf die CD kommen und da gibt ja auch sieben kurze Stücke. Und ich kann ja nur sagen, ich habe wahnsinnig viele kurze Stücke ausprobiert und gemacht. Und dann sind wir ganz oft draufgekommen, dass die Übersetzung von Ralf Dütli, ein berühmter Übersetzer, auch von Brodsky, immer so künstlich wirken. Das klingt dann gleich so, wenn man das liest, dass das plötzlich ein Gedicht ist. Also da wird nicht mehr gesagt: das ist das und das ist das. Sondern es wird zu einer Sprache gemacht, die man eigentlich nicht mehr spricht. Ganz eklatant finde ich es dann bei der Großen Elegie, die Dütli übrigens nicht übersetzt hat. Aber wenn man bei der großen Elegie die zwei unterschiedlichen anschaut: Dedecius auf der einen und auf der anderen Seite Kaempfe/Ost. Hier hat jeder, finde ich, auf seine Art und Weise geschafft, etwas Eigenes zu machen.
Alles schläft. Ja, alles schläft und alles schläft ein. Das passiert einmal 24 Minuten und einmal 17 Minuten. Also ganz am Schluss passiert natürlich ganz viel. Und ich will mich davor zurückhalten, jetzt zu sagen, dass ich weiß, was in der Elegie passiert. Aber man kann ja doch ein paar Sachen auf den Grund gehen. In dem Anfangsbild zum Beispiel ist ganz klar eine Kirche beschrieben. Da ist ein Sessel, ein Beichtstuhl. Dann habe ich mich mit der Architektur beschäftigt. Von welchem Raum wird hier in welchen Raum gegangen? Und das ist ja bei Brodsky ganz deutlich, dass es vom Kleinen, von diesem Schlafgemach ausgehend immer größer wird, bis es über die ganze Welt geht, inklusive Himmel und Hölle. Das ist der Weg. Das heißt, es wird immer größer ganz am Ende und immer allgemeiner. Es gibt auch diesen Todesgedanken darin. Ja, ganz klar. Durchaus auch, vielleicht, den Selbstmordgedanken. Ich glaube, das steckt da auch drin mit diesem Schlaf ein und lass alles gut sein und lass die Zügel locker. Das ist für mich schon auch ein Hinweis darauf. Und gerade das letzte Bild, wenn dann tatsächlich alles schläft und über Engel gesprochen wurde und diese Gesamtheit schläft. Für mich steckt da auch das drin. Ein Gehen und ein Lassen.
Doch da, hörst du es? Mit Christian Reiner hören wir; was er sagt, und vor allem, was er nicht sagen kann. Den Weißraum im Gedicht, die Pause der Rezitation. Stille, jene »Abwesenheit von beabsichtigten Geräuschen«, wie Cage sie nannte, klingt. Es liegt bedrückend nahe, in John Donnes Schlaf den Schlaf auch unserer heutigen Welt zu finden und in Christian Reiner dessen Beschwörer.
Bilder aus Teheran im April 2020: Ein Spielplatz hat nur einen vereinzelten Bewohner, ein Bus fährt auf vom Vekehr befreiten, das heißt: funktionslosen, Straßen, der Boden eines vereinsamten Basars wird gefegt. Alles Teil eines exemplarischen Kurzfilms, den der New Yorker veröffentlichte. Es ist der wörtliche und allegorische Ausdruck der Stille Teherans, aber auch Londons, New Yorks, Berlins in den Lockdowns der Pandemie. Die Welt ist verriegelt und stillgelegt. Doch da, hörst du es?
Das wusste ich vorher nicht. Mir ist das auch aufgefallen, dass das ja doch ganz schön passend ist jetzt. Alles schläft. Wir haben hier jetzt in Österreich ab 20 Uhr Ausgangssperre. Ja, so ist es, alles schläft. Mach das Fenster auf. Das Taxi schläft. Das Pferd schläft. Der Zebrastreifen schläft. Alles. Aber das wusste ich natürlich damals noch bei weitem nicht. Damit habe ich nicht gerechnet. Wir haben das zwischen 2015 und 2017 aufgenommen und da war ja noch kein Dunst von Corona und von irgendwelchen Lockdowns.
Und jetzt ist es halt tatsächlich so, dass das mitten in der Großstadt auch so ist, obwohl das vorher unvorstellbar war. Aber auch schon vorher: Wenn man an Orte kommt, in denen vielleicht gerade niemand ist oder in denen wenig ist, dann ist das ja durchaus auch etwas, das der Mensch manchmal betrachtet. Das passiert ja schon am Meer, wo es bei weitem nicht schläft und wo es bei weitem nicht ruhig ist. Aber wenn man diese Ruhe bekommt und das ist ruhig und das ist ruhig – und dass es nur in seinem Rhythmus vor sich geht. Das waren meine Assoziationen, also vor Corona, wenn die da alle schlafen, wenn es eben wirklich Nacht wird und wenn dann alles ausgeht.
Christian Reiner ist ein deutscher Musiker und Sprecher. Er ist gelernter Maschinenschlosser, ab 1994 studiert er Phonetik und Sprechkunst/Sprecherziehung in München und Stuttgart. Einem Hinweis seines Freundes Wolf Wondratschek folgend, beschäftigt er sich mit Joseph Brodsky. 2017 erscheinen die Aufnahmen zu Elegie an John Donne. Christian Reiner lebt in Wien.
Text: Joseph Brodsky, »Große Elegie an John Donne«, erschienen in Haltestelle in der Wüste(Frankfurt am Main: Suhrkamp 1997).
Produktion: Konstantin Schönfelder, Simon Böhm
Hat Ihnen dieser Text gefallen? PRÄ|POSITION ist als gemeinnütziges Projekt der »Förderung von Kunst und Kultur« verpflichtet. Das Kollektiv arbeitet allein für den Text. Doch ohne Mittel kann auf Dauer selbst Kultur nicht stattfinden. Werden Sie Freund:in von PRÄ|POSITION und unterstützen Sie uns über PayPal, damit auch kommende Texte lesbar bleiben.