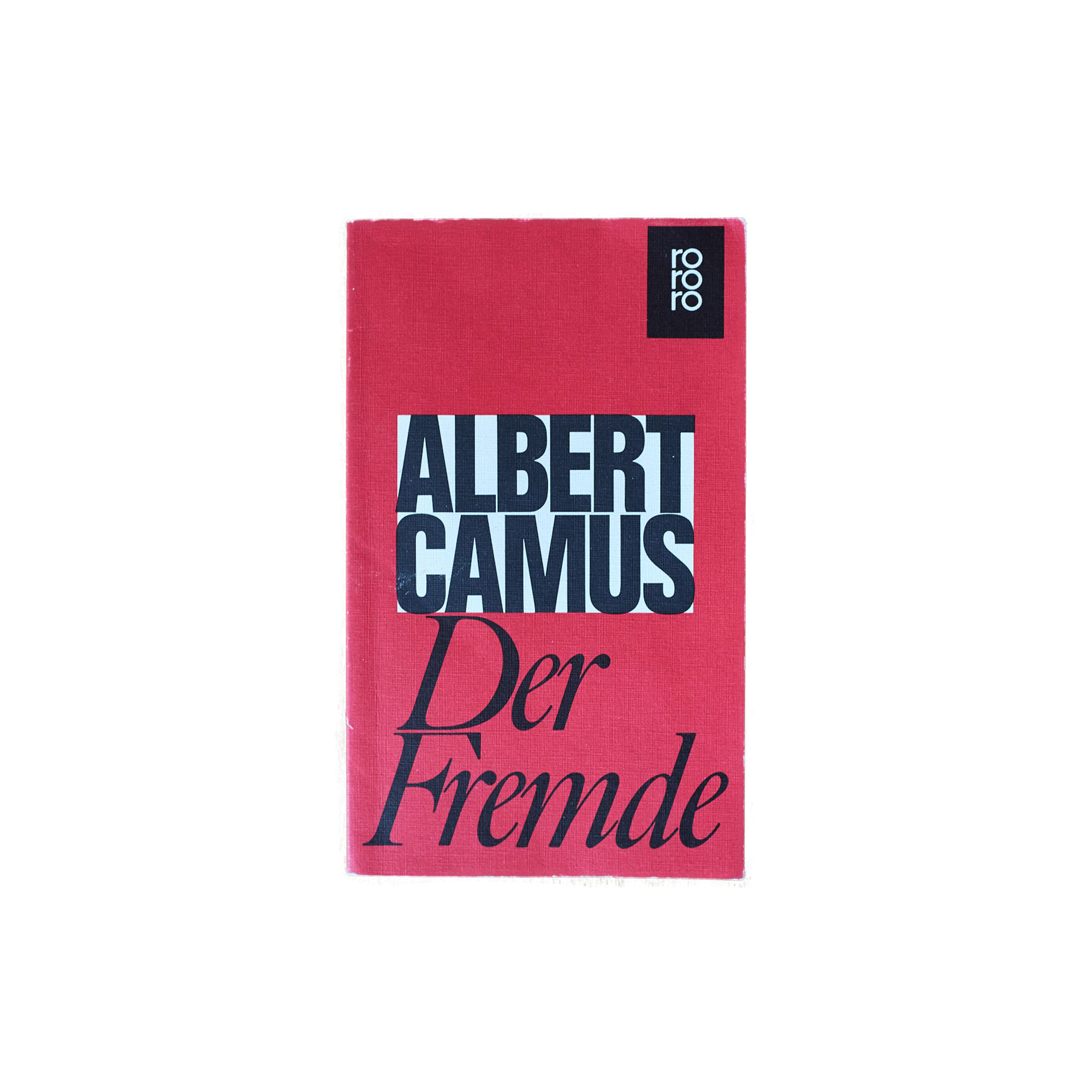#34 Albert Camus: Der Fremde
In seiner als »zärtlich« empfundenen Zuwendung zur Welt gelingt Meursault die Überbrückung des finsteren Abgrunds der Gleichgültigkeit, den zuzuschütten er und auch sonst niemand im Stande ist. Obwohl alle anderen Menschen diese Lage mit Meursault teilen, führen deren Wege anders über den Abgrund als der seine. Zu einem Schulterschluss kommt es nicht. Meursault bleibt den Menschen fremd.
Die Augen haschend, Haltepunkte suchend, die Beine rhythmisch strampelnd, dem Untergang entgegen. Was tut der, dem es auf offenem Meer an Orientierung mangelt? Verharrt der Mensch auf der Stelle und ergibt sich seinem Schicksal? Oder wird er in verschiedene Richtungen ausschwärmen, um schwimmend hoffentlich doch noch das Festland zu erreichen?
In Albert Camus‘ Roman Der Fremde badet Meursault gern im Meer, auch am Tag nach der Beerdigung seiner Mutter. Dort trifft er auf Maria Cardona, eine junge Frau, deren Bekanntschaft er schon vor einiger Zeit gemacht hatte. Nach dem gemeinsamen Schwimmen und einem Kinobesuch landen die beiden schon am selben Abend miteinander im Bett. Wenig erfahren wir über Meursaults Gefühlslage. Klar und unaufgeregt schildert der Franzose die Ereignisse des Tages und weder im Klang der Sätze noch in ihrer Wortwahl ließe sich ein Unterschied ausmachen zwischen der Beerdigungssequenz der Mutter und dem späteren Badevergnügen mit Maria. Meursault lebt, ohne sich allzu sehr zu bemühen. Er verweilt abwartend.
»Ich dachte, daß ein Sonntag vorbei und Mama nun begraben sei, daß ich wieder meine Arbeit tun würde und daß sich eigentlich nichts geändert habe.« (27)
Solchen Sätzen folgt unter Pauken und Trompeten nahezu immer Umstürzendes. Wenn auch mit Verzögerung. Denn zunächst wird Meursault Tags darauf die Bekanntschaft des brutalen Zuhälters Raymond machen und sich von ihm beim Männergespräch einen Freundschaftsbund aufschwatzen lassen, ohne sich aber wirklich als Beteiligter zu fühlen: »Mir war es gleichgültig, ob ich sein Freund war, aber er schien großen Wert darauf zu legen« (36). Mit seiner naiven Gleichgültigkeit erinnert Meursault heute womöglich entfernt an die filmische Realisierung der Romanfigur Forrest Gump, die dem bedeutungsvollen Nachdenken und der naiven Grübelei die Einfachheit des alltäglichen Handelns entgegensetzt. An dieser ganz liebenswürdigen Gutmütigkeit fehlt es Meursault ebenso, wie es ihm an Boshaftigkeit mangelt. Er lebt gedankenlos. Auf den Heiratsantrag von Maria antwortet er, als ginge es um die Wunschfarbe für einen Teppich auf den kein Licht fällt.
»Am Abend holte Maria mich ab und fragte mich, ob ich sie heiraten wolle. Ich antwortete ihr, das wäre mir einerlei, aber wir könnten heiraten, wenn sie es wolle. Da wollte sie wissen, ob ich sie liebe. Ich antwortete, wie ich schon einmal geantwortet hatte, daß das nicht so wichtig sei, daß ich sie aber zweifellos nicht liebe. »Warum willst du mich dann heiraten?« fragte sie. Ich erklärte ihr, das sei ganz unwichtig; wenn sie wollte, könnten wir heiraten.« (44)
Beinahe kindlich wirkt seine Sorglosigkeit, mit der er jedes Nachsinnen über die Konsequenzen seines Handelns abwehrt. Der Fremde lebt wie ein sich verloren Glaubender auf hoher See. Sich den Wellen ausliefernd, fremdbestimmt, ohne eigenes Zutun. Nur verzweifelt wirkt er nie. Nicht einmal im Moment des Paukenschlags, den in Camus‘ Roman fünf Pistolenschüsse bedeuten, abgefeuert auf einen gesichts- und namenlos bleibenden Araber, einem Feind Raymonds, dem Meursault am Strand begegnet. Nach seiner Festnahme wird Meursault das Blenden der Sonne als Schussursache anführen. Nie sei es seine Absicht gewesen, den Araber zu töten. Aber wirklich zur Wehr setzen wird Meursault sich nicht. Auf einen Verteidiger könne er verzichten, weil sein Fall »doch denkbar einfach« (65) läge. Im Gespräch mit seinem Pflichtverteidiger vor der Gerichtsverhandlung fährt er fort, alle Geschehnisse seines jüngsten Lebens in kühner Teilnahmslosigkeit aufzulisten, so als wäre alles einerlei: die Beerdigung der Mutter, die Liebschaft zu Maria, der Schuss am Strand. Als der Dahinlebende, der er ist, erkennt Meursault keine Zusammenhänge in seinem Lebenslauf, erkennt keine Gründe und Ursachen, nur die Zustände eines dem Zufall Ausgelieferten, was er seinem Verteidiger in kindlichem Trotz, seine eigene Lage verkennend, mitzuteilen sucht.
»Ich machte ihn darauf aufmerksam, daß das alles mit meinem Fall nichts zu tun habe, worauf er nur antwortete, offensichtlich hätte ich noch nie etwas mit dem Gericht zu tun gehabt.« (67)
Meursault fehlt die Einsicht, dass er auf offener See den Strömungen von allen Seiten ausgesetzt ist. Er nimmt sich als isolierten Menschen innerhalb einer Gemeinschaft wahr, deren Härte er unvermeidlich spüren wird. Man wird ihm den Prozess machen, der Staatsanwalt als Anwalt seiner Gemeinschaft wird, in blankem Entsetzen über die Gefühllosigkeit des Protagonisten, über dessen »Leere des Herzens« einen Abgrund wähnen, »in den die Gesellschaft stürzen kann« (101). Leben müsse Mitleben heißen. Und so will er Meursaults Kopf.
Selbst im Moment seines Todesurteils protestiert Meursault nicht. In dem Moment, an dem es an ihm läge, zu sprechen, steht nur Schweigen. In der Auflehnung gegen Norm und Erwartung weist Meursault sich als Fremder seiner Gesellschaft aus und verstößt sich sogleich aus ihr. Der Staatsanwalt sieht das bedrohliche Andere, das die Sittlichkeit aus dem Gleichgewicht bringt. Die Geschworenen sprechen kein einziges Wort, sind die Beobachter eines Schauspiels, das ihnen nicht länger etwas sagt. So ist sein Tod abgemacht. Meursault hat den Verlust jeglichen Halts längst akzeptiert, treibt mitten im Ozean auf der Stelle. Das Gnadengesuch seines Anwalts spielt keine Rolle mehr für ihn.
»Im Grunde wußte ich genau, daß es einerlei ist, ob man mit dreißig oder siebzig Jahren stirbt, denn in beiden Fällen werden andere Männer und andere Frauen leben, und zwar Tausende von Jahren hindurch. Nichts war im Grunde klarer als das. Sterben mußte immer ich – jetzt oder in zwanzig Jahren. [...] Da man sterben muß, ist es ganz unwesentlich, wann und wie – das ist klar. Also (und das Schwierige war, nicht aus dem Auge zu verlieren, was dieses »also« an Überlegungen darstellte), also mußte ich mich mit der Ablehnung meines Gesuchs abfinden.« (113–114)
Gnade ist keine juristische Größe in diesem Roman. Die Ablehnung eines rettenden Außermenschlichen ist hier die Abkehr von jenem Hoffen-Dürfen, mit dem Immanuel Kant den Raum des dem Menschen Übergeordneten, auch der Religiosität, umrissen hatte. Für Camus‘ Antihelden ist der Zugang dazu verschlossen. Dadurch offenbart er sich als der stumme Kenner des Absurden, als den wir ihn heute schätzen. Meursault macht sich in den Augen der Gesellschaft schuldig, indem er sich ihrem Leben als ein Hoffen-Dürfen in stillem Protest widersetzt. Während alle anderen voll Gottvertrauen nach dem rettenden Festlandufer schwimmen, verharrt er in Kontingenz. Denn was so oder so sein kann, kann eben auch anders sein. Gleichgültig und bei vollem Bewusstsein, verharrt er in seiner Gefängniszelle, weil er schon der Aussicht, ihr zu entrinnen, nicht ausreichend Gutes abgewinnen kann. Was würde schon auf ihn warten? Ein weiterer Sommer, dessen Amusement beim Baden im Meer, beim Kinobesuch und beim flüchtigen Gespräch mit Flurnachbarn er durchaus zu genießen wüsste. Allein, er glaubt nicht daran, dass er durch diese Mühen sich einen Weg ans Ufer legen könnte. Die eigentliche Pointe des Romans besteht darin, dass sich Meursault gerade damit in seiner entschiedenen Abwesenheit als der erweist, der wirklich an der Welt anteilnimmt, der sie im rechten Lichte zu sehen weiß und sich keiner transzendenten Hoffnung hingibt, die sich nicht sicher einlösen wird. Am Abend vor seinem Abschied entdeckt er schließlich ihrer beider Wahlverwandtschaft und versöhnt sich so mit seinem Dasein als Fremder:
»Als hätte dieser große Zorn mich von allem Übel gereinigt und mir alle Hoffnung genommen, wurde ich angesichts dieser Nacht voller Zeichen und Sterne zum erstenmal empfänglich für die zärtliche Gleichgültigkeit der Welt. Als ich empfand, wie ähnlich sie mir war, wie brüderlich, da fühlte ich, daß ich glücklich gewesen war und immer noch glücklich bin.« (122)
In seiner als »zärtlich« empfundenen Zuwendung zur Welt gelingt Meursault die Überbrückung des finsteren Abgrunds der Gleichgültigkeit, den zuzuschütten er und auch sonst niemand im Stande ist. Obwohl alle anderen Menschen diese Lage mit Meursault teilen, führen deren Wege anders über den Abgrund als der seine. Zu einem Schulterschluss kommt es nicht. Meursault bleibt den Menschen fremd.
Text: Albert Camus, Der Fremde (Rowohlt 1961)
Hat Ihnen dieser Text gefallen? PRÄ|POSITION ist als gemeinnütziges Projekt der »Förderung von Kunst und Kultur« verpflichtet. Das Kollektiv arbeitet allein für den Text. Doch ohne Mittel kann auf Dauer selbst Kultur nicht stattfinden. Werden Sie Freund:in von PRÄ|POSITION und unterstützen Sie uns über PayPal, damit auch kommende Texte lesbar bleiben.